
Tatort-Schreibtisch: Ausgezeichnet!
So geht preisgekrönt!
Auch mit Kurzgeschichten und Novellen kann man Preise gewinnen! In der Reihe "Tatort-Schreibtisch: Ausgezeichnet!" veröffentlichen wir preisgekrönte oder für einen Preis nominierteTexte, um zu zeigen, wie vielfältig Geschichten sein können, mit denen Autoren Anerkennung und Aufmerksamkeit erlangt haben. Für alle, die Schreiben wollen - zum Mut machen und zum Lernen! Interessiert? Dann scrollen Sie weiter ...
Tatort Schreibtisch: Ausgezeichnet!
Mischa Bach: "Der Tod ist ein langer trüber Fluss"
Nach einem mutmaßlichen Selbstmordversuch im Rhein weiß Ophelia nicht mehr, wer sie ist. Doch nun kann sie die Toten hören...
Auch der tote Mann, den sie an ihrem neuen Arbeitsplatz in der Bonner Gerichtsmedizin vorfindet, spricht mit ihr. Ophelia macht sich auf die Suche nach seiner Geschichte. Es ist eine Reise in eine Vergangenheit, die mehr mit ihr zu tun hat, als sie ahnt ...
Eine bewegende literarische Novelle, dicht und stimmungsvoll geschrieben
Die Kriminalnovelle "Der Tod ist ein langer trüber Fluss" wurde 2001 mit dem Martha-Saalfeld-Preis ausgezeichnet und 2005 für den Friedrich-Glauser-Preis in der sparte Debüt nominiert
ISBN 9783946312307
Print-Ausgabe: 9,99 € (A: 10,40 €)
E-Book: 6,99 €
E-Book ohne Anmeldung kaufen

Mischa Bach alias Dr. Michaela Bach lebt in Essen und wurde in Neuwied am Rhein geboren. Die Filmwissenschaftlerin, (Drehbuch-)Autorin, Journalistin, Übersetzerin und Dozentin handelt nach dem Motto "Besser gut erfunden als schlecht erinnert". Im Fall dieser rund 110 Seiten langen Kriminalnovelle "Der Tod ist ein langer trüber Fluss" – ihr Debut als Krimi-Autorin – mit großem Erfolg. Bis heute hat Mischa Bach zahlreiche Romane, Theaterstücke und Fernsehdrehbücher geschrieben und gib nun ihr Wissen und ihre Erfahrung als Dozentin und Dramturgin weiter.
LESEPROBE
Ich liebe den Fluss. Vater Rhein nennen ihn manche, und die Touristen sind ganz verliebt in seine Schiffe und seine Ufer, seine Weinbaugebiete und seine Burgen. Aber das ist es nicht. Ich liebe den Fluss wegen der Geschichten, die er zu mir bringt, selbst, wenn die meisten davon alles andere als schön sind. Ophelia nennen mich meine Kollegen, denn es sind die Geschichten seiner Toten.
Bald werde ich nicht mehr den leisen Stimmen lauschen können, die sich zu Erzählungen jenseits der weiß-grün-stahlfarbenen, sauberen Welt der Gerichtsmedizin verweben. Ich hatte in der Zeitung gelesen, die Regierung wolle unser Institut wie auch einige andere schließen. Zu teuer hieß es offiziell, aber ich denke, niemand will die Geschichten der Toten hören. Und ich, die ich vor über einem Jahr im Fluss meine eigene Geschichte verloren hatte, ich wäre dann noch einsamer in der eigenartigen Schwärze, dem Nichts meines Gedächtnisses. Zugleich schien es passend, nach der Schließung nicht mehr zu wissen, was aus mir wird. Denn nicht zu wissen, was gewesen war, meine Amnesie, war für mich ein zweites Zuhause geworden. Das war gut so, auch wenn es weder Polizei noch Ärzte begriffen: Man hatte mich aus dem Fluss gezogen, ein Selbstmordversuch hieß es. Dafür hatte es sicher gute Gründe gegeben – es war also folgerichtig, sich nicht zu erinnern. Die Frau, die es mal gegeben haben musste, die Frau ohne Namen, die in keinem Vermisstenregister auftauchte, die Frau, die sterben wollte, war tatsächlich tot. An ihrer Stelle gab es mich, Ophelia, die sonderbare Helferin in der Bonner Gerichtsmedizin, Ophelia, die Schweigende, die die Stimmen der Toten hört, die der Fluss ihr bringt. Oder doch bis jetzt gehört hatte …
Plötzlich hört das Schaukeln auf. Kein wiegendes Wasser mehr, und das Wirbeln der Schiffsschrauben wird zu rhythmischem Scheuern auf einer Kiesbank. Dann, nach einer unbestimmten, unbestimmbaren Weile wiederum Bewegung, Geräusche, wirr, verwirrend, ich bin dem Fluss entrissen!
Ich war allein im Institut, als sie ihn mir brachten; ich bin immer die erste, die kommt, und die letzte, die geht. Der junge Mann konnte nicht lange im Wasser gelegen haben, sein Körper war noch nicht bis an seine Grenzen aufgequollen. Im Gegenteil, er sah aus, als wäre er eben erst in der Badewanne eingeschlafen.
Ich füllte die Papiere für die Überstellung aus – alle Flussleichen kommen hierher. Schließlich erleiden die wenigsten einen Herzinfarkt oder dergleichen, während sie am Ufer stehen, und fallen danach unbemerkt und ohne dass sie jemand vermisst ins Wasser. Eine natürliche Todesursache ist da selten, und selbst bei Unfällen und Selbsttötungen gibt es zu viele offene Fragen. Ich informierte die diensthabende Gerichtsmedizinerin über unseren morgendlichen Gast, dann setzte ich mich zu ihm und betrachtete ihn lange.
Der Fluss hatte ihn sich früh geholt, er war vielleicht Mitte zwanzig, das Alter, auf das sie mich schätzten. Seine feuchte Haut war blass, schon beinahe bleich. Er hatte schwarzes, kurzes Haar mit ein paar langen, blauen Strähnen, die ihm im Gesicht klebten. Vorsichtig schob ich sie beiseite und sah seine Augen, die dunkel und warm gewesen sein mussten. Jetzt hatten sie den eigenartig wissenden Ausdruck derjenigen, die ihren Tod in aller Klarheit gesehen haben. Sein Lächeln dagegen war kaum als solches zu erkennen. Jedenfalls war es kein Lächeln, das ich je auf dem Gesicht eines Lebenden gesehen hatte. Manchmal sah ich dieses seltsam-wissende Lächeln, wenn mich mein Spiegelbild im Vorübergehen in einer der blank geputzten Flächen des Instituts erwischte. Manchmal sahen es auch die Kollegen, sie zuckten dann zurück und versuchten, das Schaudern mit einem Witz abzutun:
»Vielleicht hättest du dich lieber Mona Lisa nennen sollen«, sagten sie dann manchmal, und ich wusste nie, ließ das Erschrecken sie jedes Mal vergessen, dass sie diesen Satz und den folgenden bereits wiederholt geäußert hatten? Denn wie die Flut auf die Ebbe, so folgte unweigerlich der Zusatz:
»La Gioconda, die ihr eigenes Geheimnis vergessen hat, das wär doch was!«
Damit stellten sie, zumeist lachend, für sich den Normalzustand der Dinge wieder her. Ich lachte meist höflich mit und schüttelte innerlich doch den Kopf. Es waren die Brüche, Momente wie diese, die mir klarmachten, wenn ich schon einen Namen haben musste, dann Ophelia – Ophelia, die, zurückgewiesen von Hamlet, isoliert durch seinen Wahn, den Tod im Wasser sucht und findet. Mich hatte der Tod zwar nicht gewollt, dafür war es, als hätte mir der Fluss zum Abschied das Totenlächeln geschenkt.
Autorenfoto: Stephan von Kobloch
Eine bewegende literarische Novelle, dicht und stimmungsvoll geschrieben
Die Kriminalnovelle "Der Tod ist ein langer trüber Fluss" wurde 2001 mit dem Martha-Saalfeld-Preis ausgezeichnet und 2005 für den Friedrich-Glauser-Preis in der sparte Debüt nominiert
ISBN 9783946312307
Print-Ausgabe: 9,99 € (A: 10,40 €)
E-Book: 6,99 €
Buch kostenlos lesen
E-Book ohne Anmeldung kaufen

Mischa Bach alias Dr. Michaela Bach lebt in Essen und wurde in Neuwied am Rhein geboren. Die Filmwissenschaftlerin, (Drehbuch-)Autorin, Journalistin, Übersetzerin und Dozentin handelt nach dem Motto "Besser gut erfunden als schlecht erinnert". Im Fall dieser rund 110 Seiten langen Kriminalnovelle "Der Tod ist ein langer trüber Fluss" – ihr Debut als Krimi-Autorin – mit großem Erfolg. Bis heute hat Mischa Bach zahlreiche Romane, Theaterstücke und Fernsehdrehbücher geschrieben und gib nun ihr Wissen und ihre Erfahrung als Dozentin und Dramturgin weiter.
LESEPROBE
Ich liebe den Fluss. Vater Rhein nennen ihn manche, und die Touristen sind ganz verliebt in seine Schiffe und seine Ufer, seine Weinbaugebiete und seine Burgen. Aber das ist es nicht. Ich liebe den Fluss wegen der Geschichten, die er zu mir bringt, selbst, wenn die meisten davon alles andere als schön sind. Ophelia nennen mich meine Kollegen, denn es sind die Geschichten seiner Toten.
Bald werde ich nicht mehr den leisen Stimmen lauschen können, die sich zu Erzählungen jenseits der weiß-grün-stahlfarbenen, sauberen Welt der Gerichtsmedizin verweben. Ich hatte in der Zeitung gelesen, die Regierung wolle unser Institut wie auch einige andere schließen. Zu teuer hieß es offiziell, aber ich denke, niemand will die Geschichten der Toten hören. Und ich, die ich vor über einem Jahr im Fluss meine eigene Geschichte verloren hatte, ich wäre dann noch einsamer in der eigenartigen Schwärze, dem Nichts meines Gedächtnisses. Zugleich schien es passend, nach der Schließung nicht mehr zu wissen, was aus mir wird. Denn nicht zu wissen, was gewesen war, meine Amnesie, war für mich ein zweites Zuhause geworden. Das war gut so, auch wenn es weder Polizei noch Ärzte begriffen: Man hatte mich aus dem Fluss gezogen, ein Selbstmordversuch hieß es. Dafür hatte es sicher gute Gründe gegeben – es war also folgerichtig, sich nicht zu erinnern. Die Frau, die es mal gegeben haben musste, die Frau ohne Namen, die in keinem Vermisstenregister auftauchte, die Frau, die sterben wollte, war tatsächlich tot. An ihrer Stelle gab es mich, Ophelia, die sonderbare Helferin in der Bonner Gerichtsmedizin, Ophelia, die Schweigende, die die Stimmen der Toten hört, die der Fluss ihr bringt. Oder doch bis jetzt gehört hatte …
Plötzlich hört das Schaukeln auf. Kein wiegendes Wasser mehr, und das Wirbeln der Schiffsschrauben wird zu rhythmischem Scheuern auf einer Kiesbank. Dann, nach einer unbestimmten, unbestimmbaren Weile wiederum Bewegung, Geräusche, wirr, verwirrend, ich bin dem Fluss entrissen!
Ich war allein im Institut, als sie ihn mir brachten; ich bin immer die erste, die kommt, und die letzte, die geht. Der junge Mann konnte nicht lange im Wasser gelegen haben, sein Körper war noch nicht bis an seine Grenzen aufgequollen. Im Gegenteil, er sah aus, als wäre er eben erst in der Badewanne eingeschlafen.
Ich füllte die Papiere für die Überstellung aus – alle Flussleichen kommen hierher. Schließlich erleiden die wenigsten einen Herzinfarkt oder dergleichen, während sie am Ufer stehen, und fallen danach unbemerkt und ohne dass sie jemand vermisst ins Wasser. Eine natürliche Todesursache ist da selten, und selbst bei Unfällen und Selbsttötungen gibt es zu viele offene Fragen. Ich informierte die diensthabende Gerichtsmedizinerin über unseren morgendlichen Gast, dann setzte ich mich zu ihm und betrachtete ihn lange.
Der Fluss hatte ihn sich früh geholt, er war vielleicht Mitte zwanzig, das Alter, auf das sie mich schätzten. Seine feuchte Haut war blass, schon beinahe bleich. Er hatte schwarzes, kurzes Haar mit ein paar langen, blauen Strähnen, die ihm im Gesicht klebten. Vorsichtig schob ich sie beiseite und sah seine Augen, die dunkel und warm gewesen sein mussten. Jetzt hatten sie den eigenartig wissenden Ausdruck derjenigen, die ihren Tod in aller Klarheit gesehen haben. Sein Lächeln dagegen war kaum als solches zu erkennen. Jedenfalls war es kein Lächeln, das ich je auf dem Gesicht eines Lebenden gesehen hatte. Manchmal sah ich dieses seltsam-wissende Lächeln, wenn mich mein Spiegelbild im Vorübergehen in einer der blank geputzten Flächen des Instituts erwischte. Manchmal sahen es auch die Kollegen, sie zuckten dann zurück und versuchten, das Schaudern mit einem Witz abzutun:
»Vielleicht hättest du dich lieber Mona Lisa nennen sollen«, sagten sie dann manchmal, und ich wusste nie, ließ das Erschrecken sie jedes Mal vergessen, dass sie diesen Satz und den folgenden bereits wiederholt geäußert hatten? Denn wie die Flut auf die Ebbe, so folgte unweigerlich der Zusatz:
»La Gioconda, die ihr eigenes Geheimnis vergessen hat, das wär doch was!«
Damit stellten sie, zumeist lachend, für sich den Normalzustand der Dinge wieder her. Ich lachte meist höflich mit und schüttelte innerlich doch den Kopf. Es waren die Brüche, Momente wie diese, die mir klarmachten, wenn ich schon einen Namen haben musste, dann Ophelia – Ophelia, die, zurückgewiesen von Hamlet, isoliert durch seinen Wahn, den Tod im Wasser sucht und findet. Mich hatte der Tod zwar nicht gewollt, dafür war es, als hätte mir der Fluss zum Abschied das Totenlächeln geschenkt.
Buch kostenlos lesen
Autorenfoto: Stephan von Kobloch
weiterlesen
weniger
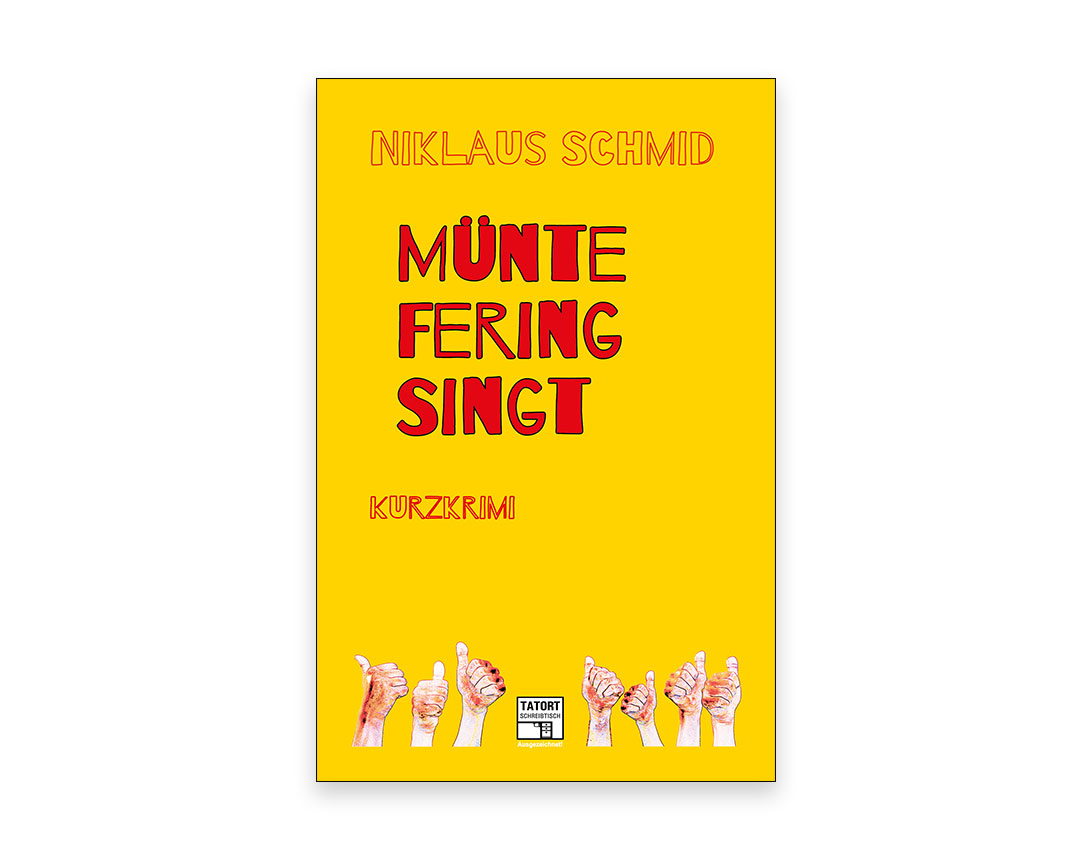
Tatort Schreibtisch: Ausgezeichnet!
Niklaus Schmid: "Müntefering singt"
Feinkostläden statt Aldi, Malediven statt Baggersee. Mit Hartz IV ist das nicht drin. Doch Ellie hat einen Plan: Wir schnappen uns einen Promi und fordern Lösegeld. Kleinganove Ulf hat Bedenken, Leibwächter und so...
Dann eben 'nen nahen Angehörigen, sagt Ellie, das ist einfach und
ungefährlich. Tatsächlich klappt alles reibungslos. Nur treten Ulf und
Ellie mit dieser Entführung etwas los, was sie niemals hätten ahnen
können …
Verblüffend, lakonisch und höchst originell!
Die Krimi-Kurzgeschichte "Müntefering singt" wurde 2005 mit dem Kulturpreis Hochsauerlandkreis ausgezeichnet.
ISBN 9783946312451
E-Book zum Download: 2,99 Euro
E-Book ohne Anmeldung kaufen

Niklaus Schmid, 1942 geboren, lebt seit 1978 als freier Schriftsteller in Duisburg und auf Formentera. Er schreibt Reisebücher, Hörspiele und Krimis. Seine Romane mit dem Privatdetektiv Elmar Mogge – Der Hundeknochen und Bienenfresser (Grafit Verlag) – spielen auf Ibiza und Formentera. Für seine Kurzgeschichte Müntefering singt wurde er mit dem Kulturpreis Hochsauerlandkreis ausgezeichnet.
LESEPROBE
„Wie war die Arbeit, Ulf?“
„Mies. Knapp dreihundert“, antwortete ich, während ich mein Spezialwerkzeug und das Spürgerät für Alarmanlagen im Flur ablegte. Endlich Feierabend.
„Also, statt Malediven nur Diemelsee.“
„Tut mir leid, Ellie. Kein Mensch hat mehr Bargeld im Haus; Kreditkarten, Telebanking –wie soll man denn da seinem Beruf nachgehen?“
„Such dir einen anderen!“, rief meine Frau aus der Küche. „Wie wär’s mit ’ner Entführung? Das ist doch die Branche, in der heute das große Geld gemacht wird.“ Sie rieb sich die Hände an den Hüften trocken und gab mir einen Kuss. „Wir schnappen uns einen Promi“, sagte sie etwas später, als sie das Essen brachte, und hatte auch gleich einen Namen parat. „Den Rüdiger Hoffmann.“
„Ellie, das meinst du nicht wirklich. Der ist doch dauernd auf Tournee.“ Ich rückte den Stuhl zurecht, setzte mich aufrecht und legte die Hände auf die Oberschenkel. „Halloo, erst mal“, machte ich den Komiker nach. „Ich weiß gar nicht, ob Sie’s wussten, aber ich bin ja entführt worden … Nee, nee, da lachen doch die Leute.“
Ellie lachte auch, aber auf ihre strenge Art. „Dann eben einen Ernsthaften. Den Friedrich Merz, der ist seriös und hat seinen Wahlkreis hier im Hochsauerland.“
Ich wiegte den Kopf. „Seriös schon, aber Lösegeld? Das gibt uns die Angela Merkel höchstens, damit wir ihn behalten. Und den Stoiber noch zusätzlich entführen.“ Ich sprach so drauflos, mit vollem Mund, was man nicht tun soll, kaute langsam, wollte Zeit gewinnen. Denn wenn Ellie erst einmal eine Idee hat, dann ist sie davon nur sehr schwer wieder abzubringen. Meine nächtlichen Besuche in den Villen der Umgebung, auch das war ihre Idee gewesen. Vorher hatte ich so dies und jenes gemacht, Musik auf der Straße, illegale CDs, oft auch gar nichts.
„Ein bisschen zäh. Das Fleisch, meine ich.“
„War im Angebot.“ Ellie räumte den Teller ab. Aber das Thema war damit noch lange nicht vom Tisch. Als sie die Nachspeise brachte, fing sie wieder an: „Dann eben den Müntefering. Der kommt auch aus unsrer Gegend, wurde in Neheim geboren, ist in Sundern zur Schule gegangen, hat da gearbeitet, war Stadtrat. Den kennt jeder, der ist beliebt, der ist wichtig, den brauchen sie, der Kanzler und die gesamte SPD. Für den Münte würden sie zahlen. Aus der Parteikasse.“
Ich zog mir den Pudding heran. „War der auch im Angebot?“ Ich hob den Löffel vor die Augen und sprach, um die Situation zu entschärfen, wie der Mann aus der Sendung mit der Maus: „Das ist Franz Müntefering. Die Genossen von der Basis nennen ihn Münte. Hört sich seltsam an, stimmt aber. Münte ist ein wichtiger Politiker. Wichtige Politiker werden von Leibwächtern bewacht. Rund um die Uhr. Das macht man so, weil sie wichtig sind. Entführer haben da keine Chance …“
„Lenk nicht ab, Ulf. Haben sie doch, eine Chance! Wenn sie klug sind und auf ihre Frau hören!“ Ellie stemmte die Hände in die Hüften, ein Zeichen, dass sie es ernst meinte und keinen Widerspruch duldete. „Und wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, fahren wir bald auf die Malediven und das Fleisch und den Nachtisch kaufen wir nur noch in Feinkostgeschäften ein.“ Ihre Augen funkelten. „Grins nicht so! Ich erklär dir das.“
Verblüffend, lakonisch und höchst originell!
Die Krimi-Kurzgeschichte "Müntefering singt" wurde 2005 mit dem Kulturpreis Hochsauerlandkreis ausgezeichnet.
ISBN 9783946312451
E-Book zum Download: 2,99 Euro
Buch kostenlos lesen
E-Book ohne Anmeldung kaufen

Niklaus Schmid, 1942 geboren, lebt seit 1978 als freier Schriftsteller in Duisburg und auf Formentera. Er schreibt Reisebücher, Hörspiele und Krimis. Seine Romane mit dem Privatdetektiv Elmar Mogge – Der Hundeknochen und Bienenfresser (Grafit Verlag) – spielen auf Ibiza und Formentera. Für seine Kurzgeschichte Müntefering singt wurde er mit dem Kulturpreis Hochsauerlandkreis ausgezeichnet.
LESEPROBE
„Wie war die Arbeit, Ulf?“
„Mies. Knapp dreihundert“, antwortete ich, während ich mein Spezialwerkzeug und das Spürgerät für Alarmanlagen im Flur ablegte. Endlich Feierabend.
„Also, statt Malediven nur Diemelsee.“
„Tut mir leid, Ellie. Kein Mensch hat mehr Bargeld im Haus; Kreditkarten, Telebanking –wie soll man denn da seinem Beruf nachgehen?“
„Such dir einen anderen!“, rief meine Frau aus der Küche. „Wie wär’s mit ’ner Entführung? Das ist doch die Branche, in der heute das große Geld gemacht wird.“ Sie rieb sich die Hände an den Hüften trocken und gab mir einen Kuss. „Wir schnappen uns einen Promi“, sagte sie etwas später, als sie das Essen brachte, und hatte auch gleich einen Namen parat. „Den Rüdiger Hoffmann.“
„Ellie, das meinst du nicht wirklich. Der ist doch dauernd auf Tournee.“ Ich rückte den Stuhl zurecht, setzte mich aufrecht und legte die Hände auf die Oberschenkel. „Halloo, erst mal“, machte ich den Komiker nach. „Ich weiß gar nicht, ob Sie’s wussten, aber ich bin ja entführt worden … Nee, nee, da lachen doch die Leute.“
Ellie lachte auch, aber auf ihre strenge Art. „Dann eben einen Ernsthaften. Den Friedrich Merz, der ist seriös und hat seinen Wahlkreis hier im Hochsauerland.“
Ich wiegte den Kopf. „Seriös schon, aber Lösegeld? Das gibt uns die Angela Merkel höchstens, damit wir ihn behalten. Und den Stoiber noch zusätzlich entführen.“ Ich sprach so drauflos, mit vollem Mund, was man nicht tun soll, kaute langsam, wollte Zeit gewinnen. Denn wenn Ellie erst einmal eine Idee hat, dann ist sie davon nur sehr schwer wieder abzubringen. Meine nächtlichen Besuche in den Villen der Umgebung, auch das war ihre Idee gewesen. Vorher hatte ich so dies und jenes gemacht, Musik auf der Straße, illegale CDs, oft auch gar nichts.
„Ein bisschen zäh. Das Fleisch, meine ich.“
„War im Angebot.“ Ellie räumte den Teller ab. Aber das Thema war damit noch lange nicht vom Tisch. Als sie die Nachspeise brachte, fing sie wieder an: „Dann eben den Müntefering. Der kommt auch aus unsrer Gegend, wurde in Neheim geboren, ist in Sundern zur Schule gegangen, hat da gearbeitet, war Stadtrat. Den kennt jeder, der ist beliebt, der ist wichtig, den brauchen sie, der Kanzler und die gesamte SPD. Für den Münte würden sie zahlen. Aus der Parteikasse.“
Ich zog mir den Pudding heran. „War der auch im Angebot?“ Ich hob den Löffel vor die Augen und sprach, um die Situation zu entschärfen, wie der Mann aus der Sendung mit der Maus: „Das ist Franz Müntefering. Die Genossen von der Basis nennen ihn Münte. Hört sich seltsam an, stimmt aber. Münte ist ein wichtiger Politiker. Wichtige Politiker werden von Leibwächtern bewacht. Rund um die Uhr. Das macht man so, weil sie wichtig sind. Entführer haben da keine Chance …“
„Lenk nicht ab, Ulf. Haben sie doch, eine Chance! Wenn sie klug sind und auf ihre Frau hören!“ Ellie stemmte die Hände in die Hüften, ein Zeichen, dass sie es ernst meinte und keinen Widerspruch duldete. „Und wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, fahren wir bald auf die Malediven und das Fleisch und den Nachtisch kaufen wir nur noch in Feinkostgeschäften ein.“ Ihre Augen funkelten. „Grins nicht so! Ich erklär dir das.“
Buch kostenlos lesen
weiterlesen
weniger
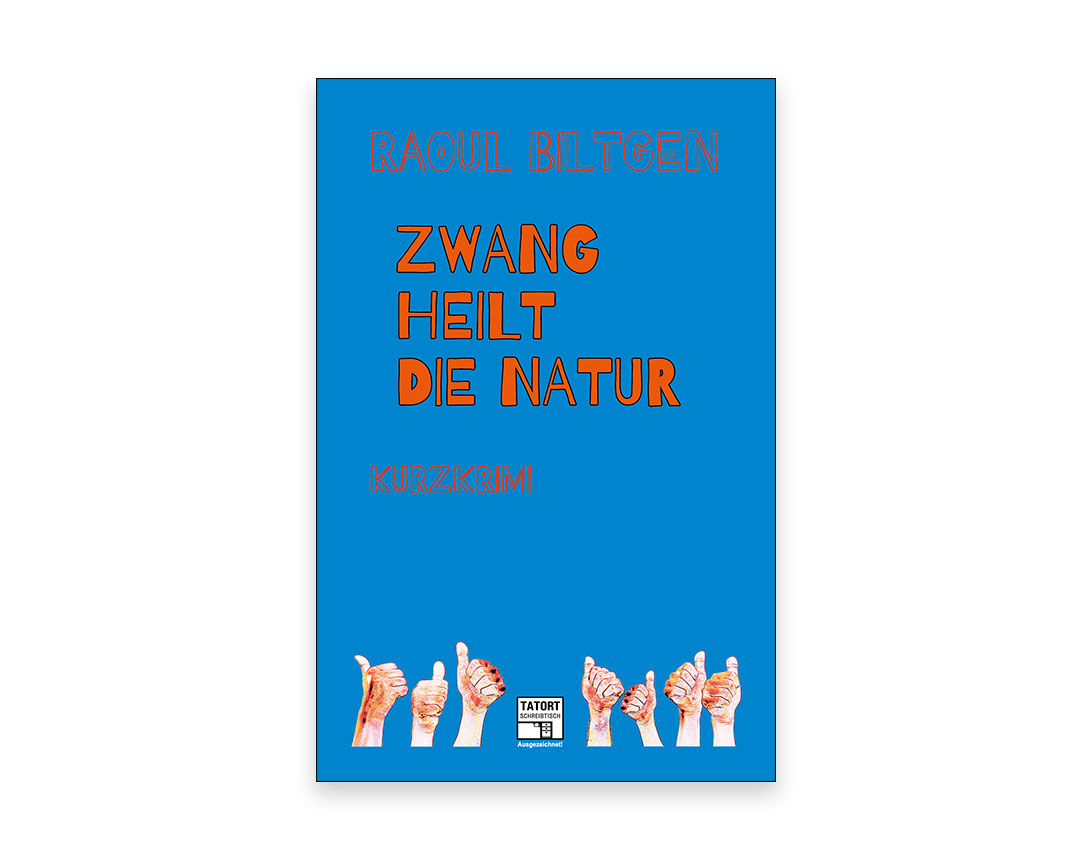
Tatort Schreibtisch: Ausgezeichnet!
Raoul Biltgen: Zwang heilt die Natur
Raoul Biltgen ist tot. Schreibt Raoul Biltgen. Er kann sich nicht erinnern. Warum er gestorben sein könnte. Oder ob er gar nicht tot ist. Er findet sich wieder in einer Psychiatrie, in jener Psychiatrie, in der auch Friedrich Glauser, der Begründer des deutschsprachigen Krimis, einst eingesessen hatte. Und in der er seinen Kriminalroman „Matto regiert“ spielen ließ. Ist Raoul Biltgen, Autor und Protagonist der eigenen Geschichte, verrückt?Oder verdrängt er aus gutem Grund, was ihn an jenen Fluss getrieben hat,
an dem er sich tot sieht? Eine atemberaubende Verfolgungsjagd auf den
eigenen Spuren führt den Leser in einem schnellen Hin und Her zwischen
Traum und Wirklichkeit, Realität und Fiktion durch das beschauliche
schweizerische Städtchen Münsingen, immer vor dem drohenden Vergessen
davonlaufend...
Ein raffinierter Krimi mit ungewöhnlicher Erzählstruktur
Die Kurzgeschichte „Zwang heilt die Natur“ wurde für den Friedrich-Glauser-Preis 2014 in der Sparte Kurz-Krimi nominiert.
ISBN 9783946312499
E-Book zum Download: 2,99 €
E-Book ohne Anmeldung kaufen

Raoul Biltgen, geboren 1974 in Luxemburg, lebt in Wien, er ist Schauspieler, Schriftsteller und Psychotherapeut. Als Autor schrieb er zahlreiche Kurzgeschichten, Theaterstücke und Bücher, außerdem verfasst er eine wöchentliche Liebes- und Sexkolumne. 2014 und 2017 wurde er mit seinen Kurzgeschichten für den Friedrich-Glauser-Preis in der Sparte „Kurzkrimi“ nominiert. Im Kick-Verlag erschien außerdem der Beitrag „Überleben vor Leuten“ in dem Ratgeber „Hört mir jemand zu?“.
LESEPROBE
Erste noch müde Sonnenstrahlen fallen durch die schwarzen Äste der frühlingskahlen Bäume und lassen die zwirbelnden Wellen des Flusses glitzern wie zerspringende Diamanten, ein Entenpärchen, sie unscheinbar braun, er mit grün schimmerndem Hals, die Schnäbel ins Gefieder gesteckt, döst im geschützten Halbrund zwischen den wie ein zerschlagener Unterkiefer im Wasser liegenden Betonblöcken vor sich hin. Die Enten lassen sich nicht stören durch das wilde Frühstücksgezwitscher der Vögel, genauso wenig wie durch den nach und nach anschwellenden Lärm der Autos und Laster auf der Autobahn, hundert, vielleicht zweihundert Meter weit weg, im Rücken des Mannes, der, die schwarze Lederjacke fest um den Körper, die Arme um die Jacke geschlungen auf der morgenfeuchten Erde am Rande des kleinen Beckens am reißenden Fluß sitzt und scheinbar den Enten zuschaut. Man fragt sich, warum er nicht auf der Bank sitzt. Man fragt sich, wie lange der Mann schon dort sitzt. Man fragt sich, was mit dem Mann ist, da er vollkommen reglos da sitzt. Und wenn ich sage vollkommen, dann meine ich vollkommen, denn nicht einmal jenes unwillkürliche Auf und Ab der Schultern, das beim Atmen entsteht, ist zu sehen.
Der Mann ist tot.
Und der Mann bin ich.
Nun wird der geübte Krimileser wissen wollen, wie ich denn, tot, an den Fluss gekommen bin. Der Realist hingegen wird einwenden, dass ein Toter wohl kaum über sich selber als Toter reden kann. Womit er recht hat. Weswegen ich auf die erste Frage zurückkommen möchte: Ich weiß auch nicht, wie ich dorthin gekommen bin, es handelt sich lediglich um ein Traumbild, das ich, seit ich vor ein paar Stunden aus diesem Traum erwacht bin, einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommen kann. Was mich durchaus beunruhigt. Wer will schon sich selber als Leiche an einem Fluss sehen?
Noch aufwühlender wird das Ganze aber, wenn ich sage, wo ich mich genau in diesem Moment, da ich diese Zeilen zu Bildschirm bringe, befinde, nämlich unter jungfräulich weißen Laken in einem Bett im PZM liegend, dem Psychiatriezentrum Münsingen, alterwürdiges Gemäuer am Rande des Dorfes nahe Bern in der Schweiz.
Und wieder meldet sich der Realist: Kein Wunder, dass diesem Menschen solch psychotisch anmutenden Bilder im Hirn kleben, er ist halt verrückt, sitzt da in seiner Gummizelle, vollgepumpt mit pharmazeutischen Erzeugnissen, nicht fähig, klar zu denken, plemmplemm.
Leider kann ich diesen hypotethischen Einwänden nicht widersprechen, auch wenn ich nicht denke, dass ich verrückt bin. Vielleicht gestört. Mich stört da was. Was stört mich da?
Autorenfoto: Bianca Kübler
Ein raffinierter Krimi mit ungewöhnlicher Erzählstruktur
Die Kurzgeschichte „Zwang heilt die Natur“ wurde für den Friedrich-Glauser-Preis 2014 in der Sparte Kurz-Krimi nominiert.
ISBN 9783946312499
E-Book zum Download: 2,99 €
E-Book ohne Anmeldung kaufen

Raoul Biltgen, geboren 1974 in Luxemburg, lebt in Wien, er ist Schauspieler, Schriftsteller und Psychotherapeut. Als Autor schrieb er zahlreiche Kurzgeschichten, Theaterstücke und Bücher, außerdem verfasst er eine wöchentliche Liebes- und Sexkolumne. 2014 und 2017 wurde er mit seinen Kurzgeschichten für den Friedrich-Glauser-Preis in der Sparte „Kurzkrimi“ nominiert. Im Kick-Verlag erschien außerdem der Beitrag „Überleben vor Leuten“ in dem Ratgeber „Hört mir jemand zu?“.
LESEPROBE
Erste noch müde Sonnenstrahlen fallen durch die schwarzen Äste der frühlingskahlen Bäume und lassen die zwirbelnden Wellen des Flusses glitzern wie zerspringende Diamanten, ein Entenpärchen, sie unscheinbar braun, er mit grün schimmerndem Hals, die Schnäbel ins Gefieder gesteckt, döst im geschützten Halbrund zwischen den wie ein zerschlagener Unterkiefer im Wasser liegenden Betonblöcken vor sich hin. Die Enten lassen sich nicht stören durch das wilde Frühstücksgezwitscher der Vögel, genauso wenig wie durch den nach und nach anschwellenden Lärm der Autos und Laster auf der Autobahn, hundert, vielleicht zweihundert Meter weit weg, im Rücken des Mannes, der, die schwarze Lederjacke fest um den Körper, die Arme um die Jacke geschlungen auf der morgenfeuchten Erde am Rande des kleinen Beckens am reißenden Fluß sitzt und scheinbar den Enten zuschaut. Man fragt sich, warum er nicht auf der Bank sitzt. Man fragt sich, wie lange der Mann schon dort sitzt. Man fragt sich, was mit dem Mann ist, da er vollkommen reglos da sitzt. Und wenn ich sage vollkommen, dann meine ich vollkommen, denn nicht einmal jenes unwillkürliche Auf und Ab der Schultern, das beim Atmen entsteht, ist zu sehen.
Der Mann ist tot.
Und der Mann bin ich.
Nun wird der geübte Krimileser wissen wollen, wie ich denn, tot, an den Fluss gekommen bin. Der Realist hingegen wird einwenden, dass ein Toter wohl kaum über sich selber als Toter reden kann. Womit er recht hat. Weswegen ich auf die erste Frage zurückkommen möchte: Ich weiß auch nicht, wie ich dorthin gekommen bin, es handelt sich lediglich um ein Traumbild, das ich, seit ich vor ein paar Stunden aus diesem Traum erwacht bin, einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommen kann. Was mich durchaus beunruhigt. Wer will schon sich selber als Leiche an einem Fluss sehen?
Noch aufwühlender wird das Ganze aber, wenn ich sage, wo ich mich genau in diesem Moment, da ich diese Zeilen zu Bildschirm bringe, befinde, nämlich unter jungfräulich weißen Laken in einem Bett im PZM liegend, dem Psychiatriezentrum Münsingen, alterwürdiges Gemäuer am Rande des Dorfes nahe Bern in der Schweiz.
Und wieder meldet sich der Realist: Kein Wunder, dass diesem Menschen solch psychotisch anmutenden Bilder im Hirn kleben, er ist halt verrückt, sitzt da in seiner Gummizelle, vollgepumpt mit pharmazeutischen Erzeugnissen, nicht fähig, klar zu denken, plemmplemm.
Leider kann ich diesen hypotethischen Einwänden nicht widersprechen, auch wenn ich nicht denke, dass ich verrückt bin. Vielleicht gestört. Mich stört da was. Was stört mich da?
Autorenfoto: Bianca Kübler
weiterlesen
weniger
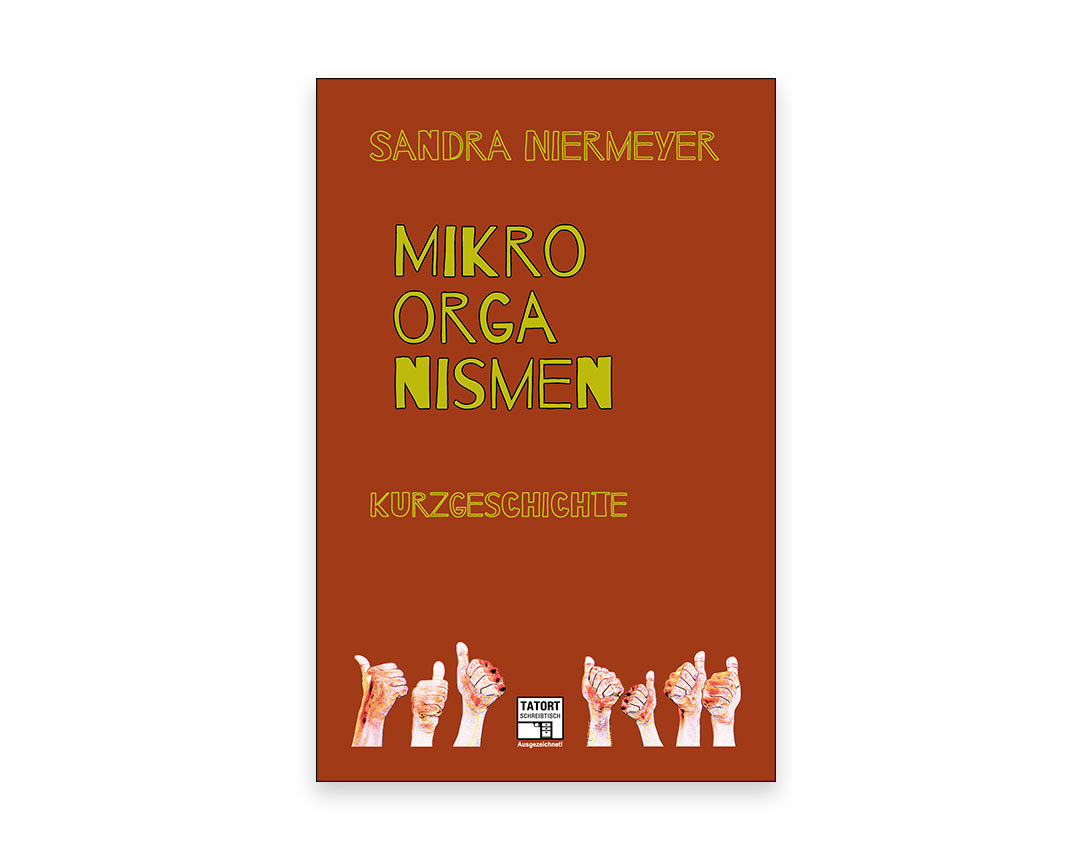
Tatort Schreibtisch: Ausgezeichnet!
Ein suggestive und faszinierende Innensicht eine Frau am Rand des Vergessens
Die Kurzgeschichte „Mikroorganismen“ wurde im Jahr 2007 mit dem Marlen-Haushofer-Literaturpreis Steyr ausgezeichnet.
ISBN 9783946312437
E-Book zum Download: 1,99 €
E-Book ohne Anmeldung kaufen

Sandra Niermeyer, geboren 1972 in Melle/Niedersachsen, lebt nach vielen Jahren in Bielefeld nun mit ihrer Familie in der Nähe von Würzburg. Sie gewann für ihre in Anthologien, Zeitschriften und Zeitungen veröffentlichten Texte eine Reihe von Preisen und Auszeichnungen: den Würth-Literaturpreis der Tübinger Poetik-Dozentur, den Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für junge Künstlerinnen und Künstler in der Sparte Dichtung und Schriftstellerei sowie den Marlen-Haushofer-Literaturpreis der Stadt Steyr. 2004 und 2006 wurde sie für den Friedrich-Glauser-Preis in der Sparte Kurzkrimi nominiert
LESEPROBE
Die Wohnung hatte Holzfußboden. Im Schlafzimmer stand ein alter Schrank mit Geschirr. Wenn sie an dem Schrank vorbei ging, klirrte das Geschirr leise. Sie nahm es manchmal heraus und wusch es über dem alten Spülstein, der früher in einem Keller gewesen war. Sie mußte sich dabei bücken, das Dach über der Küche war abgeschrägt. Ein Badezimmer hatte sie nicht, nur den Spülstein. Alles war provisorisch, jetzt zum Schluß. Sie setzte sich in den Ohrensessel, in dem sie fast ganz versank, und sah aus dem Dachfenster in den Himmel. Der Kondensstreifen eines Flugzeuges verblaßte langsam. Sie schlief ein. Sie schlief oft tagsüber, kaum noch nachts. Der Schlaf kam nur, wenn sie nicht auf ihn wartete. An ihre Träume konnte sie sich nicht erinnern. Sie schlief kurz und hatte nachher einen schlechten Geschmack im Mund.
Das Telefon klingelte, es schepperte auf dem kleinen Glastisch. Sie schreckte hoch. Das Klingeln hörte sich anders an, als sie es in Erinnerung hatte. Sie hob den schweren Hörer von der Gabel und sagte: „Ja?“
„Mathilde?“, hörte sie am anderen Ende.
Sie wartete. Sie war nicht Mathilde.
„Nein, nicht Mathilde,“ sagte sie. Der Hörer am anderen Ende wurde aufgelegt. „Warten Sie,“ sagte sie. Sie überlegte. Dann legte sie den Hörer zurück auf die Gabel. Sie war nicht Mathilde.
Sandra Niermeyer: Mikororganismen
Sie ist alt. Sie wartet in ihrer Wohnung. Das Klingeln des Telefons hört sich anders an als sie es in Erinnerung hat. Plötzlich steht ein Staubsaugervertreter in ihrer Wohnung. Hat sie ihn herein gelassen? Und ist dort wirklich ein zweiter Mann im Flur, oder bildet sie sich das ein? Mathilde kann sich ihrer nicht mehr sicher sein ...Ein suggestive und faszinierende Innensicht eine Frau am Rand des Vergessens
Die Kurzgeschichte „Mikroorganismen“ wurde im Jahr 2007 mit dem Marlen-Haushofer-Literaturpreis Steyr ausgezeichnet.
ISBN 9783946312437
E-Book zum Download: 1,99 €
E-Book ohne Anmeldung kaufen

Sandra Niermeyer, geboren 1972 in Melle/Niedersachsen, lebt nach vielen Jahren in Bielefeld nun mit ihrer Familie in der Nähe von Würzburg. Sie gewann für ihre in Anthologien, Zeitschriften und Zeitungen veröffentlichten Texte eine Reihe von Preisen und Auszeichnungen: den Würth-Literaturpreis der Tübinger Poetik-Dozentur, den Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für junge Künstlerinnen und Künstler in der Sparte Dichtung und Schriftstellerei sowie den Marlen-Haushofer-Literaturpreis der Stadt Steyr. 2004 und 2006 wurde sie für den Friedrich-Glauser-Preis in der Sparte Kurzkrimi nominiert
LESEPROBE
Die Wohnung hatte Holzfußboden. Im Schlafzimmer stand ein alter Schrank mit Geschirr. Wenn sie an dem Schrank vorbei ging, klirrte das Geschirr leise. Sie nahm es manchmal heraus und wusch es über dem alten Spülstein, der früher in einem Keller gewesen war. Sie mußte sich dabei bücken, das Dach über der Küche war abgeschrägt. Ein Badezimmer hatte sie nicht, nur den Spülstein. Alles war provisorisch, jetzt zum Schluß. Sie setzte sich in den Ohrensessel, in dem sie fast ganz versank, und sah aus dem Dachfenster in den Himmel. Der Kondensstreifen eines Flugzeuges verblaßte langsam. Sie schlief ein. Sie schlief oft tagsüber, kaum noch nachts. Der Schlaf kam nur, wenn sie nicht auf ihn wartete. An ihre Träume konnte sie sich nicht erinnern. Sie schlief kurz und hatte nachher einen schlechten Geschmack im Mund.
Das Telefon klingelte, es schepperte auf dem kleinen Glastisch. Sie schreckte hoch. Das Klingeln hörte sich anders an, als sie es in Erinnerung hatte. Sie hob den schweren Hörer von der Gabel und sagte: „Ja?“
„Mathilde?“, hörte sie am anderen Ende.
Sie wartete. Sie war nicht Mathilde.
„Nein, nicht Mathilde,“ sagte sie. Der Hörer am anderen Ende wurde aufgelegt. „Warten Sie,“ sagte sie. Sie überlegte. Dann legte sie den Hörer zurück auf die Gabel. Sie war nicht Mathilde.
weiterlesen
weniger

Tatort Schreibtisch: Ausgezeichnet!
H.P. Karr: Wofür halten Sie mich?
Sommer. Hitze. Auf dem Balkon im Plattenbau: eine Portion geballter Sex. Brüste, Beine, Bauch, Bikini. Und auf einmal: ein Toter...Der Kommissar und seine Kollegin stoßen bei ihren Ermittlungen auf die
eine Wahrheit. Und auf die andere Wahrheit. Sicher ist nur eins: Sex sells.
Ein raffinierter Mord in der Hitze des Sommers
Die Kurzgeschichte „Wofür halten Sie mich“ wurde im Jahr 2004 für den Friedrich-Glauser-Preis 2004 in der Sparte Kurzkrimi nominiert.
ISBN 9783946312482
E-Book zum Download: 2,99 €
E-Book ohne Anmeldung kaufen

H.P. Karr, geboren 1955 in Saalfeld, lebt seit 1960 im Ruhrgebiet und schrieb bisher zahlreiche Storys, Hörspiele und mit Walter Wehner die »Gonzo«-Thriller »Geierfrühling«, »Rattensommer«, »Hühnerherbst« und »Bullenwinter«. 1996 erhielt das Team Karr&Wehner den Friedrich-Glauser-Preis für den besten Krimi des Jahres und 2000 den Literaturpreis Ruhrgebiet.,
LESEPROBE
Sommer. 30 Grad. Ich liege auf dem Balkon. Die Sonne brennt, die Luft steht zwischen den Häusern Wer hat eigentlich gesagt, dass der Plattenbau in der DDR erfunden worden ist? Die Anlage hier heißt Eichengrund. Sieben Blöcke, jeweils zehn Etagen, auf dem verbrannten Rasen gegeneinander versetzt, und weit und breit keine Eichen zu sehen. Dafür die Autobahn hinter Schallschutzwänden, die freilich nicht die wabernden Abgasschwaden abhalten, die die Luft schwer und süß nach Benzin riechen lassen.
Mitten im Eichengrund der Eichenplatz — auch da keine Eiche, sondern eine mickrige Linde an einem trockenen Brunnen aus Waschbeton. Ein Supermarkt, eine Sparkasse, eine Videothek, ein Tattooshop mit Postagentur und ein paar Läden für neue Klamotten, neue gebrauchte Klamotten und gebrauchte gebrauchte Klamotten. Eine Pizzeria mit Straßenverkauf, eine Dönerbude, eine Trinkhalle, und das war’s dann.
Hier auf dem Balkon ist es einigermaßen auszuhalten bei der Hitze. Das Hoch heißt Attila und grillt uns seit einer Woche. Im Appartement steht die Luft, nachts schwitze ich beim Telefonieren, als würde ich im Stahlwerk anschaffen. Ich hab dann die Fenster und die Balkontür auf und was Leichtes an, aber das hilft alles nicht wirklich.
Drüben blitzt das Fernglas. Nummer 56 im fünften Stock. Ein Typ mit Bauch und Pferdeschwanz, Dreitagebart, Shorts und Netzshirt. Wenn er nicht von seinem Balkon rüberspannt, steht er mit seinen Kumpels an der Trinkhalle am Eichenplatz, Bier in der einen Hand, Zigarette in der anderen.
Jetzt allerdings hat er das Fernglas in der einen Hand und wahrscheinlich sein Ding in der anderen.
Drinnen klingelt das Telefon. No, Sir — heute nicht! Ich habe meinen Einteiler an, ziemlich knapp geschnitten und hoch angesetzt an den Schenkeln. Meine Haut glänzt vom Nussöl, mit dem ich mich eingerieben habe. Dazu der dünne Schweißfilm. Diese Sonne. Nachmittags knallt sie direkt auf meine Seite, von drei bis halb sieben. Mehr als genug, um sich ordentlich durchzugrillen. Die Balkone haben keine Sichtblenden, nur Metallgeländer, die halb durchgerostet in der Wand hängen. Deshalb kann der Typ drüben mich jetzt auch komplett sehen, fernglasfüllend sozusagen.
Ich lasse meine Hand zwischen die Schenkel gleiten, reibe den flachen Hügel, während die andere auf der Brust liegt. Meine Titten sind perfekt. Meine Hand bewegt sich erst träge, dann schneller. Das Fernglasblitzen zittert, und ich ahne, dass er jetzt schon halb überm Geländer hängt und nicht weiß, wie er sich festhalten soll, wo er doch alle Hände voll zu tun hat...
Ein raffinierter Mord in der Hitze des Sommers
Die Kurzgeschichte „Wofür halten Sie mich“ wurde im Jahr 2004 für den Friedrich-Glauser-Preis 2004 in der Sparte Kurzkrimi nominiert.
ISBN 9783946312482
E-Book zum Download: 2,99 €
E-Book ohne Anmeldung kaufen

H.P. Karr, geboren 1955 in Saalfeld, lebt seit 1960 im Ruhrgebiet und schrieb bisher zahlreiche Storys, Hörspiele und mit Walter Wehner die »Gonzo«-Thriller »Geierfrühling«, »Rattensommer«, »Hühnerherbst« und »Bullenwinter«. 1996 erhielt das Team Karr&Wehner den Friedrich-Glauser-Preis für den besten Krimi des Jahres und 2000 den Literaturpreis Ruhrgebiet.,
LESEPROBE
Sommer. 30 Grad. Ich liege auf dem Balkon. Die Sonne brennt, die Luft steht zwischen den Häusern Wer hat eigentlich gesagt, dass der Plattenbau in der DDR erfunden worden ist? Die Anlage hier heißt Eichengrund. Sieben Blöcke, jeweils zehn Etagen, auf dem verbrannten Rasen gegeneinander versetzt, und weit und breit keine Eichen zu sehen. Dafür die Autobahn hinter Schallschutzwänden, die freilich nicht die wabernden Abgasschwaden abhalten, die die Luft schwer und süß nach Benzin riechen lassen.
Mitten im Eichengrund der Eichenplatz — auch da keine Eiche, sondern eine mickrige Linde an einem trockenen Brunnen aus Waschbeton. Ein Supermarkt, eine Sparkasse, eine Videothek, ein Tattooshop mit Postagentur und ein paar Läden für neue Klamotten, neue gebrauchte Klamotten und gebrauchte gebrauchte Klamotten. Eine Pizzeria mit Straßenverkauf, eine Dönerbude, eine Trinkhalle, und das war’s dann.
Hier auf dem Balkon ist es einigermaßen auszuhalten bei der Hitze. Das Hoch heißt Attila und grillt uns seit einer Woche. Im Appartement steht die Luft, nachts schwitze ich beim Telefonieren, als würde ich im Stahlwerk anschaffen. Ich hab dann die Fenster und die Balkontür auf und was Leichtes an, aber das hilft alles nicht wirklich.
Drüben blitzt das Fernglas. Nummer 56 im fünften Stock. Ein Typ mit Bauch und Pferdeschwanz, Dreitagebart, Shorts und Netzshirt. Wenn er nicht von seinem Balkon rüberspannt, steht er mit seinen Kumpels an der Trinkhalle am Eichenplatz, Bier in der einen Hand, Zigarette in der anderen.
Jetzt allerdings hat er das Fernglas in der einen Hand und wahrscheinlich sein Ding in der anderen.
Drinnen klingelt das Telefon. No, Sir — heute nicht! Ich habe meinen Einteiler an, ziemlich knapp geschnitten und hoch angesetzt an den Schenkeln. Meine Haut glänzt vom Nussöl, mit dem ich mich eingerieben habe. Dazu der dünne Schweißfilm. Diese Sonne. Nachmittags knallt sie direkt auf meine Seite, von drei bis halb sieben. Mehr als genug, um sich ordentlich durchzugrillen. Die Balkone haben keine Sichtblenden, nur Metallgeländer, die halb durchgerostet in der Wand hängen. Deshalb kann der Typ drüben mich jetzt auch komplett sehen, fernglasfüllend sozusagen.
Ich lasse meine Hand zwischen die Schenkel gleiten, reibe den flachen Hügel, während die andere auf der Brust liegt. Meine Titten sind perfekt. Meine Hand bewegt sich erst träge, dann schneller. Das Fernglasblitzen zittert, und ich ahne, dass er jetzt schon halb überm Geländer hängt und nicht weiß, wie er sich festhalten soll, wo er doch alle Hände voll zu tun hat...
weiterlesen
weniger
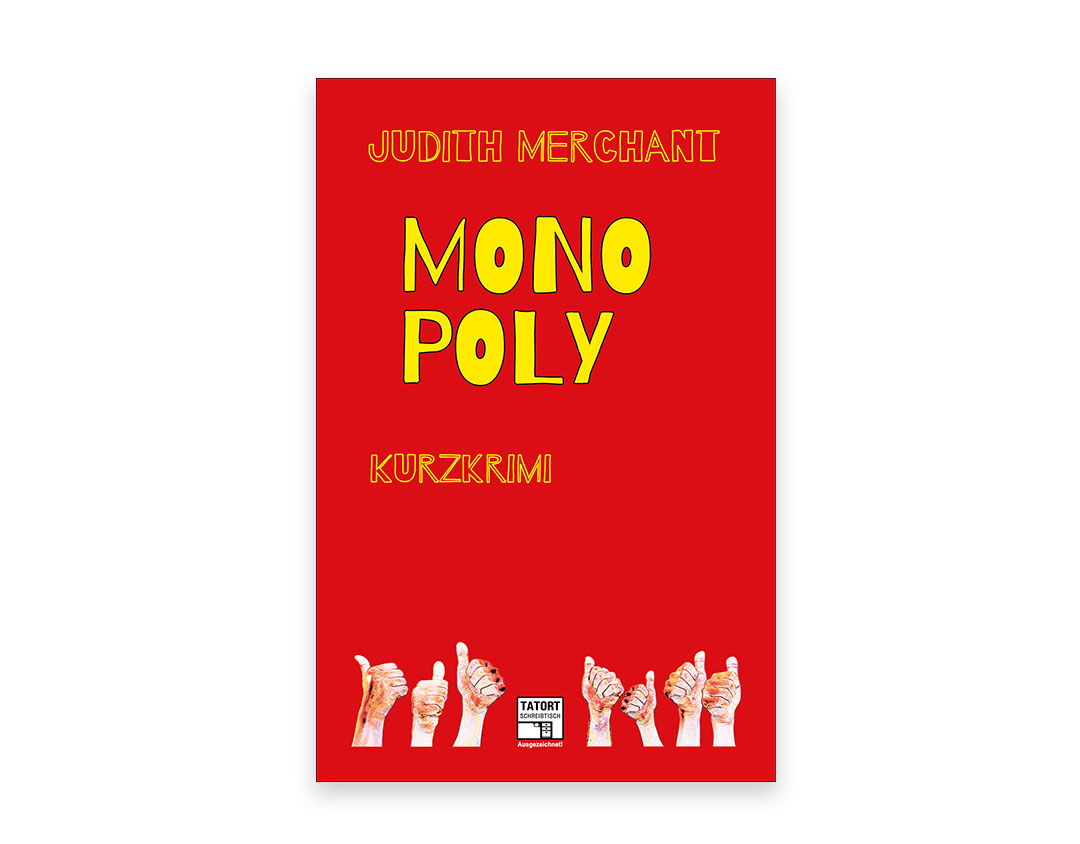
Tatort Schreibtisch: Ausgezeichnet!
Ein fesselnder Krimi mit überraschendem Finale
Die Kurzgeschichte „Monopoly“ wurde mit dem Friedrich-Glauser-Preis 2009 in der Sparte Kurz-Krimi ausgezeichnet.
ISBN 9783946312444
E-Book zum Download: 2,99 €
E-Book ohne Anmeldung kaufen

Judith Merchant studierte Literaturwissenschaft und unterrichtet heute an der Bonner Universität Creative Writing. Für ihre Kurzgeschichten wurde sie zweimal mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet. Mit „Nibelungenmord“ und „Loreley singt nicht mehr“ startete sehr erfolgreich ihre Krimireihe um Jan Seidel, die mit "Rapunzelgrab" fortgesetzt wurde. Außerdem schrieb sie mit „Die Lügen jener Nacht“ einen psychologischen Spannungsroman.
LESEPROBE
Alles im Leben hat seinen Preis.
Nicht immer ist er fair und deutlich ausgezeichnet, aber zahlen muss man ihn früher oder später, irgendwo da oben sitzt ein Spielleiter, er führt Buch und passt auf, dass die Bilanzen stimmen.
Am besten funktionieren die Menschen miteinander, wenn sie sich über den Preis für das, was sie austauschen, einig sind.
Wer abschreiben lässt, bekommt auch eine Einladung zum Kindergeburtstag. Ein roter Sportwagen für die Ehefrau macht eine Reise mit der Geliebten nach Mallorca. Langeweile am Frühstückstisch bis dass der Tod sie scheidet, aber sie sitzen beide nie alleine vor dem Fernseher.
Manchmal muss man zahlen, obwohl man denkt, man habe ein Geschenk bekommen.
Und manchmal hat man etwas verschenkt, und der andere will es bezahlen.
Das kann dann tödlich enden.
15.09 Uhr
An Mord und Totschlag denke ich noch nicht, als ich an diesem Freitag an der Kasse stehe, dafür bin ich viel zu sehr mit meinem neuen Mantel beschäftigt: Kirschrot und in der Taille ganz eng reicht er mir fast bis zu den Stiefeln, geradezu unanständig gut sehe ich darin aus und bin hingerissen, eigentlich ist er ja zu teuer, aber ich habe ihn verdient, denn es ist mein dreißigster Geburtstag.
Hallo, Sie, sagt die Verkäuferin mit dem schillernden Augen-Make-up, und da merke ich, dass ich an der Reihe bin.
Ich behalte ihn gleich an, sage ich, mit spitzen Fingern reiche ich ihr einen Zipfel kirschroten Wollstoffs, an dem das metallene Sicherungsetikett hängt.
Neunundneunzig Euro, nuschelt sie, entfernt das Etikett und nimmt meine ec-Karte entgegen. Sie zieht sie durch den Schlitz des Lesegeräts, wartet, runzelt die Stirn und versucht es wieder. Geht nicht, sagt sie dann und reicht mir die Karte. Entweder das Konto ist leer oder Ihre Karte ist gesperrt.
Kann nicht sein, sage ich, und das Rot, das fühlbar heiß in meine Wangen schießt, ist Wut und nicht Scham, aber ich weiß, dass man das von außen nicht sieht, und das nervt mich. Ich habe noch genug Geld drauf, das weiß ich genau.
Sie zuckt die Achseln, wirft einen Blick auf die Wartenden hinter mir und schürzt die Lippen. Dann müssen Sie wohl bar bezahlen.
Ich öffne mein Portemonnaie, obwohl ich genau weiß, dass nichts drin ist, seit ich kein Gehalt mehr bekomme, hebe ich immer nur fünfzig Euro auf einmal ab, die ungeduldigen Blicke der Verkäuferin bedrängen mich, ich klimpere demonstrativ mit dem Kleingeld und greife suchend in meine Tasche, meine Finger ertasten einen Packen steifer, zweifach gekniffener Papierstücke, das Format stimmt, aber ich glaube nicht daran, ich ziehe sie hervor und starre ungläubig darauf, grüne Scheine, drei Stück.
Na also, geht doch, sagte die Verkäuferin und reißt mir einen der Scheine aus der Hand, dafür muss sie sich vorbeugen, sie schüttelt den Kopf, während sie in ihrer Kasse wühlt.
Ich gehe langsam aus dem Laden, die beiden verbliebenen Scheine in der Hand, die Tüte mit meinen alten Sachen schneidet mir ins Handgelenk, wie kommt das Geld in meine Tasche, gestern Abend war es noch nicht drin, ich erinnere mich, dass ich meinen letzten Zehner ausgegeben habe, außerdem, so viel habe ich niemals dabei, jemand anders muss es mir hineingesteckt haben.
Ich erstarre.
Dann gehe ich zurück zu der Verkäuferin, drängle mich vor, schiebe die anderen einfach aus dem Weg.
Geben Sie mir den Schein zurück.
In diesem Augenblick denke ich schon daran, dass es Tote geben wird, jemand wird aus dieser Nummer nicht lebend rauskommen, das Geld hätte nicht in meiner Tasche sein dürfen, aber vorerst habe ich ein anderes Problem zu lösen.
Hallo, Sie da? Wenn Sie das Geld zurück wollen, müssen Sie den Mantel ausziehen, sagt die Tusse.
Aber ich werde den Mantel nicht ausziehen, auf gar keinen Fall, wie kann ich das tun, wenn ich darunter nichts trage als nackte Haut und ein paar Liebesbisse.
Autorenfoto: Herff
Judith Merchant: "Monopoly"
Sie erwacht verkatert nach einer rauschenden Liebesnacht in ihrem Bett. Der Kerl ist verschwunden. Aber er hat ihr etwas dagelassen: drei Hundert-Euro-Scheine ... Mit nichts als einem roten Mantel bekleidet rauscht sie quer durch die Stadt, um sie ihm zurück zu geben – notfalls mit Gewalt...Ein fesselnder Krimi mit überraschendem Finale
Die Kurzgeschichte „Monopoly“ wurde mit dem Friedrich-Glauser-Preis 2009 in der Sparte Kurz-Krimi ausgezeichnet.
ISBN 9783946312444
E-Book zum Download: 2,99 €
Buch kostenlos lesen
E-Book ohne Anmeldung kaufen

Judith Merchant studierte Literaturwissenschaft und unterrichtet heute an der Bonner Universität Creative Writing. Für ihre Kurzgeschichten wurde sie zweimal mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet. Mit „Nibelungenmord“ und „Loreley singt nicht mehr“ startete sehr erfolgreich ihre Krimireihe um Jan Seidel, die mit "Rapunzelgrab" fortgesetzt wurde. Außerdem schrieb sie mit „Die Lügen jener Nacht“ einen psychologischen Spannungsroman.
LESEPROBE
Alles im Leben hat seinen Preis.
Nicht immer ist er fair und deutlich ausgezeichnet, aber zahlen muss man ihn früher oder später, irgendwo da oben sitzt ein Spielleiter, er führt Buch und passt auf, dass die Bilanzen stimmen.
Am besten funktionieren die Menschen miteinander, wenn sie sich über den Preis für das, was sie austauschen, einig sind.
Wer abschreiben lässt, bekommt auch eine Einladung zum Kindergeburtstag. Ein roter Sportwagen für die Ehefrau macht eine Reise mit der Geliebten nach Mallorca. Langeweile am Frühstückstisch bis dass der Tod sie scheidet, aber sie sitzen beide nie alleine vor dem Fernseher.
Manchmal muss man zahlen, obwohl man denkt, man habe ein Geschenk bekommen.
Und manchmal hat man etwas verschenkt, und der andere will es bezahlen.
Das kann dann tödlich enden.
15.09 Uhr
An Mord und Totschlag denke ich noch nicht, als ich an diesem Freitag an der Kasse stehe, dafür bin ich viel zu sehr mit meinem neuen Mantel beschäftigt: Kirschrot und in der Taille ganz eng reicht er mir fast bis zu den Stiefeln, geradezu unanständig gut sehe ich darin aus und bin hingerissen, eigentlich ist er ja zu teuer, aber ich habe ihn verdient, denn es ist mein dreißigster Geburtstag.
Hallo, Sie, sagt die Verkäuferin mit dem schillernden Augen-Make-up, und da merke ich, dass ich an der Reihe bin.
Ich behalte ihn gleich an, sage ich, mit spitzen Fingern reiche ich ihr einen Zipfel kirschroten Wollstoffs, an dem das metallene Sicherungsetikett hängt.
Neunundneunzig Euro, nuschelt sie, entfernt das Etikett und nimmt meine ec-Karte entgegen. Sie zieht sie durch den Schlitz des Lesegeräts, wartet, runzelt die Stirn und versucht es wieder. Geht nicht, sagt sie dann und reicht mir die Karte. Entweder das Konto ist leer oder Ihre Karte ist gesperrt.
Kann nicht sein, sage ich, und das Rot, das fühlbar heiß in meine Wangen schießt, ist Wut und nicht Scham, aber ich weiß, dass man das von außen nicht sieht, und das nervt mich. Ich habe noch genug Geld drauf, das weiß ich genau.
Sie zuckt die Achseln, wirft einen Blick auf die Wartenden hinter mir und schürzt die Lippen. Dann müssen Sie wohl bar bezahlen.
Ich öffne mein Portemonnaie, obwohl ich genau weiß, dass nichts drin ist, seit ich kein Gehalt mehr bekomme, hebe ich immer nur fünfzig Euro auf einmal ab, die ungeduldigen Blicke der Verkäuferin bedrängen mich, ich klimpere demonstrativ mit dem Kleingeld und greife suchend in meine Tasche, meine Finger ertasten einen Packen steifer, zweifach gekniffener Papierstücke, das Format stimmt, aber ich glaube nicht daran, ich ziehe sie hervor und starre ungläubig darauf, grüne Scheine, drei Stück.
Na also, geht doch, sagte die Verkäuferin und reißt mir einen der Scheine aus der Hand, dafür muss sie sich vorbeugen, sie schüttelt den Kopf, während sie in ihrer Kasse wühlt.
Ich gehe langsam aus dem Laden, die beiden verbliebenen Scheine in der Hand, die Tüte mit meinen alten Sachen schneidet mir ins Handgelenk, wie kommt das Geld in meine Tasche, gestern Abend war es noch nicht drin, ich erinnere mich, dass ich meinen letzten Zehner ausgegeben habe, außerdem, so viel habe ich niemals dabei, jemand anders muss es mir hineingesteckt haben.
Ich erstarre.
Dann gehe ich zurück zu der Verkäuferin, drängle mich vor, schiebe die anderen einfach aus dem Weg.
Geben Sie mir den Schein zurück.
In diesem Augenblick denke ich schon daran, dass es Tote geben wird, jemand wird aus dieser Nummer nicht lebend rauskommen, das Geld hätte nicht in meiner Tasche sein dürfen, aber vorerst habe ich ein anderes Problem zu lösen.
Hallo, Sie da? Wenn Sie das Geld zurück wollen, müssen Sie den Mantel ausziehen, sagt die Tusse.
Aber ich werde den Mantel nicht ausziehen, auf gar keinen Fall, wie kann ich das tun, wenn ich darunter nichts trage als nackte Haut und ein paar Liebesbisse.
Buch kostenlos lesen
Autorenfoto: Herff
weiterlesen
weniger

Tatort Schreibtisch: Ausgezeichnet!
Ein düstere Rache mit düsterem Finale.
Die Kurzgeschichte „Hechte der Nacht“ wurde für den Friedrich-Glauser-Preis in der Kategorie Kurzkrimi 2015 nominiert.
ISBN 9783946312420
E-Book zum Download: 1,99 €
E-Book ohne Anmeldung kaufen

Christiane Dieckerhoff lebt mit ihrem Mann, dem Musiker Eckhard Dieckerhoff, am nördlichen Rand des Ruhrgebiets. Als Christiane Dieckerhoff schreibt sie vorwiegend Spreewaldkrimis und als Anne Breckenridge historische Romane. Gemeinsam mit ihrem Mann gestaltet sie die Leseshow „Mord & Musik“ mit Texten aus ihren Büchern und dazu passenden Musikstücken.
LESEPROBE
Lachen schallt über das Wasser. Stimmen. Musik. Fröhlich sind die Hochzeitsgäste. Ausgelassen. Ahnungslos. Sie wissen nicht, dass ich hier bin. Mein Kahn: ein dunkler Fleck auf der Schwärze des Wassers. Ich selbst: regungslos am Rudel. Eingeladen: Bin ich nicht. Warum auch? Ausgemustert. Nicht zum Zug gekommen. Denken alle. Und die, die es besser wissen, schweigen.
Eine echt sorbische Hochzeit feiert sie. Wer hätte das gedacht: damals, im November.
Die Kraniche sammelten sich auf den nassen Wiesen zwischen den Fließen, als sie ihren Koffer auf den Anleger hievte. Aus Berlin ist sie gekommen. Die Nichte vom Hechtwirt. Jeder wusste, dass sie kommen würde. Also waren mehr Kähne auf dem Fließ als zur Hauptsaison, wenn die Kombinate hier wie Mückenschwärme einfallen.
Auch ich war da. Kam grad von den Reusen. Ich war schneller vom Kahn als die anderen. Hab einfach das Rudel in die Böschung gerammt und bin los. Also hab ich ihr den Koffer in den Schankraum getragen. Und dann standen wir vor der Theke, nur sie und ich und ich hab auf die Knospen ihrer kleinen Titten gestarrt, die sich durch ihr Baumwolltrikot drückten. Unsere Lehder Mädchen tragen Büstenhalter wie Brustschilde, da sieht man nichts.
Peggy heiß ich, hat sie gesagt und ich hab ihr gefallen. Das hab ich gesehen, an der Art, wie sie mich angeschaut hat.
Django hab ich geantwortet, obwohl in meinem Pass Mario steht. Dabei hab ich ihr ins Gesicht geschaut. Ich wollte sehen, wenn die Klappe fällt. Zigeunerblut macht empfindlich.
Die Augen hast du danach, hat sie gesagt und dann hat sie noch gesagt: Schwarz wie die Sünde, was? Als sie das gesagt hat, ist ein Grübchen in ihrer linken Wange aufgetaucht. Ganz nah am Mundwinkel. Und ich war froh, dass ich meine Hände in den Hosentaschen hatte, sonst hätte ich die Hand danach ausgestreckt, um mit dem Daumen drüber zu streichen...
Christiane Dieckerhoff: Hechte der Nacht
Eine echt sorbische Hochzeit feiert sie, doch im Schatten des Flusses lauert das Böse...Ein düstere Rache mit düsterem Finale.
Die Kurzgeschichte „Hechte der Nacht“ wurde für den Friedrich-Glauser-Preis in der Kategorie Kurzkrimi 2015 nominiert.
ISBN 9783946312420
E-Book zum Download: 1,99 €
E-Book ohne Anmeldung kaufen

Christiane Dieckerhoff lebt mit ihrem Mann, dem Musiker Eckhard Dieckerhoff, am nördlichen Rand des Ruhrgebiets. Als Christiane Dieckerhoff schreibt sie vorwiegend Spreewaldkrimis und als Anne Breckenridge historische Romane. Gemeinsam mit ihrem Mann gestaltet sie die Leseshow „Mord & Musik“ mit Texten aus ihren Büchern und dazu passenden Musikstücken.
LESEPROBE
Lachen schallt über das Wasser. Stimmen. Musik. Fröhlich sind die Hochzeitsgäste. Ausgelassen. Ahnungslos. Sie wissen nicht, dass ich hier bin. Mein Kahn: ein dunkler Fleck auf der Schwärze des Wassers. Ich selbst: regungslos am Rudel. Eingeladen: Bin ich nicht. Warum auch? Ausgemustert. Nicht zum Zug gekommen. Denken alle. Und die, die es besser wissen, schweigen.
Eine echt sorbische Hochzeit feiert sie. Wer hätte das gedacht: damals, im November.
Die Kraniche sammelten sich auf den nassen Wiesen zwischen den Fließen, als sie ihren Koffer auf den Anleger hievte. Aus Berlin ist sie gekommen. Die Nichte vom Hechtwirt. Jeder wusste, dass sie kommen würde. Also waren mehr Kähne auf dem Fließ als zur Hauptsaison, wenn die Kombinate hier wie Mückenschwärme einfallen.
Auch ich war da. Kam grad von den Reusen. Ich war schneller vom Kahn als die anderen. Hab einfach das Rudel in die Böschung gerammt und bin los. Also hab ich ihr den Koffer in den Schankraum getragen. Und dann standen wir vor der Theke, nur sie und ich und ich hab auf die Knospen ihrer kleinen Titten gestarrt, die sich durch ihr Baumwolltrikot drückten. Unsere Lehder Mädchen tragen Büstenhalter wie Brustschilde, da sieht man nichts.
Peggy heiß ich, hat sie gesagt und ich hab ihr gefallen. Das hab ich gesehen, an der Art, wie sie mich angeschaut hat.
Django hab ich geantwortet, obwohl in meinem Pass Mario steht. Dabei hab ich ihr ins Gesicht geschaut. Ich wollte sehen, wenn die Klappe fällt. Zigeunerblut macht empfindlich.
Die Augen hast du danach, hat sie gesagt und dann hat sie noch gesagt: Schwarz wie die Sünde, was? Als sie das gesagt hat, ist ein Grübchen in ihrer linken Wange aufgetaucht. Ganz nah am Mundwinkel. Und ich war froh, dass ich meine Hände in den Hosentaschen hatte, sonst hätte ich die Hand danach ausgestreckt, um mit dem Daumen drüber zu streichen...
weiterlesen
weniger
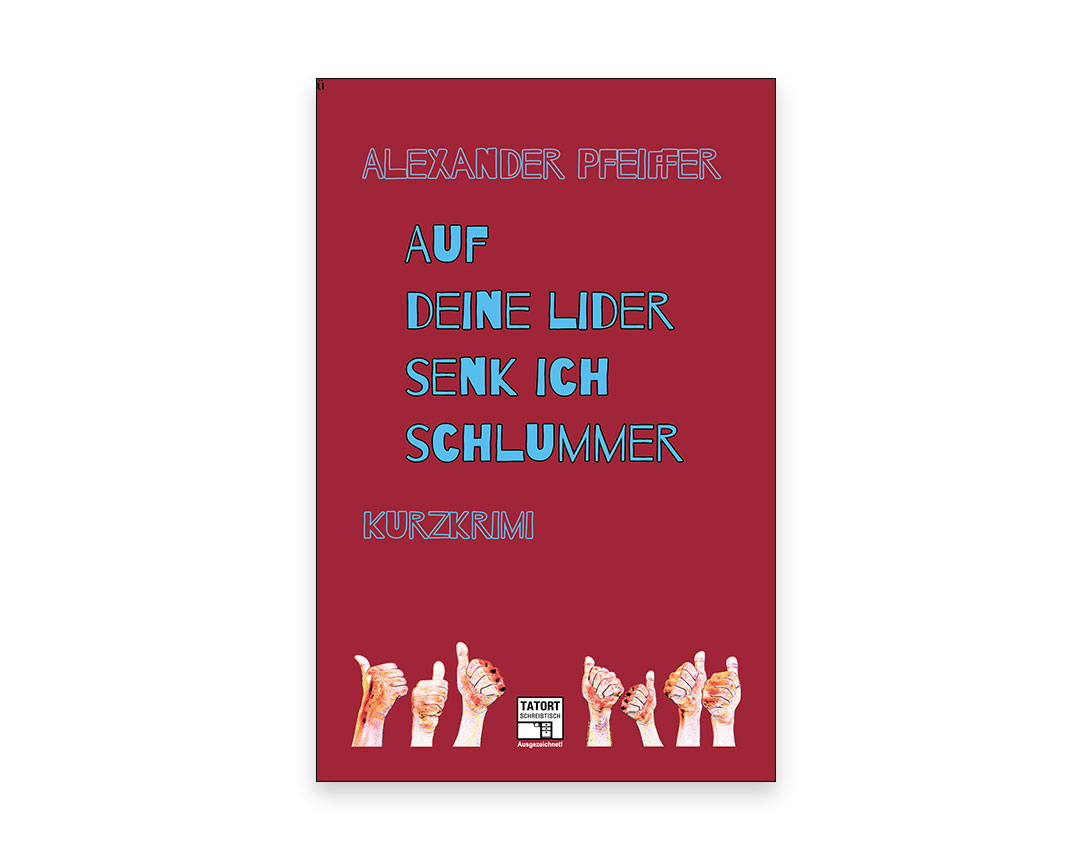
Tatort-Schreibtisch: Ausgezeichnet!
Alexander Pfeiffer: Auf deine Lider senk ich Schlummer
"Wenn man in unserem Job anfängt, Tagebuch zu schreiben, dann ist das der Anfang vom Ausstieg", weiß der Erzähler dieser Geschichte. Sein Job ist der des Dealers, der Ausstieg das erklärte Ziel. Ob der einsame Protagonist den Ausstieg schafft?Das enthüllt der Text dieser Kurzgeschichte nicht. Doch den Weg dahin zeichnet Alexander Pfeiffer beinahe
beiläufig in mosaikartig angeordneten Szenen eines nächtlichen
Großstadtdschungels, der seine Geheimnisse erst nach und nach preisgibt.
Eine Geschichte wie ein Film Noir, die sofort berührt.
Die Kurzgeschichte „Auf deine Lider senk ich Schlummer“ wurde mit dem Friedrich-Glauser-Preis 2014 in der Sparte Kurz-Krimi ausgezeichnet.
ISBN 9783946312406
E-Book zum Download: 2,99 €
E-Book ohne Anmeldung kaufen

Alexander Pfeiffer wurde 1971 in Wiesbaden geboren, wo er bis heute lebt. Er ist Schriftsteller, Kulturjournalist, Literaturveranstalter, Moderator und Workshopleiter. Von 2007 bis 2014 war er hessischer Landesvorsitzender des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS). Neben zwei Bänden mit Kurzgeschichten und drei Gedichtbänden veröffentlichte er bislang vier Kriminalromane und gab die Anthologiereihe »KrimiKommunale« heraus. 2014 erhielt er den Friedrich-Glauser-Preis in der Sparte Kurzkrimi für die Story »Auf deine Lider senk ich Schlummer«, ursprünglich veröffentlicht in der Anthologie »Küche, Diele, Mord« (Hrsg.: Almuth Heuner, KBV-Verlag, 2013). Zuletzt erschienen sein Roman »Geisterchoral« (Emons-Verlag, Köln 2016), der Gedichtband »Begrabt mein Herz an der Biegung der Schwalbacher Straße« (gONZoverlag, Mainz 2017), sowie der Gedichtband »Leuchtfeuer« (Rodney’s Underground Press, 2017). Pfeiffer ist unbelehrbarer Fan des Hamburger SV, musikabhängiger Vinylfetischist und Hobbyboxer.
LESEPROBE
Von da oben kommen Geräusche, die da nicht sein sollten. Gar nichts sollte da sein. Weil da niemand ist. Nur ein verdammter Speicher ist da, ein Dachboden voller Staub, Spinnweben, zurückgelassenem Müll und ausrangierter Möbelstücke der Vormieter, praktisch direkt über meiner Zimmerdecke.
Die Wohnung ist neu. Teil eines neuen Lebens. Hoffe ich jedenfalls. Noch bin ich dabei, mich einzurichten. An diesem Schreibtisch hier sitze ich drei Stockwerke hoch über dem Straßenlärm. Über mir und diesem Speicher haust ein Schlag Tauben, dann kommt nur noch der Himmel.
Direkt unterhalb meines Fensters schwankt eine Laterne an einem dicken Draht über der Straße im Wind. Ihr gelber Schein tastet den Asphalt ab, während sich in den Fensterscheiben gegenüber die Lichterfront eines Kinos spiegelt. Tagsüber brüten hinter diesen Scheiben BWL-Studenten. Wenn sie wollten, könnten sie zu mir reinschauen, wie ich am Schreibtisch sitze. Aber ich sitze selten tagsüber hier.
Wenn ich die drei Stockwerke runter gehe und aus der Haustür trete, tagsüber, dann stellt sich mir eine Traube aus Fahrgästen der städtischen Verkehrsbetriebe entgegen, aus Einkäufern und Rumtreibern, aus überforderten Jungmüttern mit Kinderwagen und lebenssicheren BWL-Studentinnen mit Aktenordern. Aber ich gehe selten tagsüber runter.
Ein Kollege hat mir mal gesagt, wenn man in unserem Job anfängt, Tagebuch zu schreiben, dann ist das der Anfang vom Ausstieg. Ich habe erst kürzlich mit dem Schreiben angefangen. Nicht jede Nacht. Aber fast jede. Ich schreibe ein Heft voll, schmeiße es weg, fange ein neues an. Ich habe einen ganzen Stapel davon im Regal neben dem Schreibtisch. Ein Sonderangebot aus dem Kaufhaus.
Langes Wochenende. Mit dem Tag der Arbeit am Montag als Draufgabe. Kampftag der Arbeiterbewegung – und alle haben frei. Die Stammkunden sind ganz versessen darauf, dass ihnen die Vorräte nicht ausgehen. Erst in letzter Minute entscheiden sie sich, was zu kaufen, aber dann brauchen sie es sofort. Mein Handy gibt kaum Ruhe.
Es ist neun Uhr am Abend, als ich aus dem Haus trete. Die Fahrgäste der städtischen Verkehrsbetriebe, die Einkäufer und Rumtreiber, die überforderten Jungmütter mit ihren Kinderwagen und die lebenssicheren BWL-Studentinnen mit ihren Aktenordern haben sich alle verzogen. Der Wind treibt alte Zeitungen und Werbeprospekte durch die Straße. Vor dem Kino steht mein BMW. Die schwarze Lackierung des 3erCoupés glänzt in der Lichterfront, die einen Film namens Safe Haven ankündigt. Die Xenon-Scheinwerfer blitzen auf, als ich die Türverriegelung aufschnappen lasse, das Chrom der Sternspeichen glänzt kurz im Licht.
Autorenfoto: Carina Faust
Eine Geschichte wie ein Film Noir, die sofort berührt.
Die Kurzgeschichte „Auf deine Lider senk ich Schlummer“ wurde mit dem Friedrich-Glauser-Preis 2014 in der Sparte Kurz-Krimi ausgezeichnet.
ISBN 9783946312406
E-Book zum Download: 2,99 €
E-Book ohne Anmeldung kaufen

Alexander Pfeiffer wurde 1971 in Wiesbaden geboren, wo er bis heute lebt. Er ist Schriftsteller, Kulturjournalist, Literaturveranstalter, Moderator und Workshopleiter. Von 2007 bis 2014 war er hessischer Landesvorsitzender des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS). Neben zwei Bänden mit Kurzgeschichten und drei Gedichtbänden veröffentlichte er bislang vier Kriminalromane und gab die Anthologiereihe »KrimiKommunale« heraus. 2014 erhielt er den Friedrich-Glauser-Preis in der Sparte Kurzkrimi für die Story »Auf deine Lider senk ich Schlummer«, ursprünglich veröffentlicht in der Anthologie »Küche, Diele, Mord« (Hrsg.: Almuth Heuner, KBV-Verlag, 2013). Zuletzt erschienen sein Roman »Geisterchoral« (Emons-Verlag, Köln 2016), der Gedichtband »Begrabt mein Herz an der Biegung der Schwalbacher Straße« (gONZoverlag, Mainz 2017), sowie der Gedichtband »Leuchtfeuer« (Rodney’s Underground Press, 2017). Pfeiffer ist unbelehrbarer Fan des Hamburger SV, musikabhängiger Vinylfetischist und Hobbyboxer.
LESEPROBE
Von da oben kommen Geräusche, die da nicht sein sollten. Gar nichts sollte da sein. Weil da niemand ist. Nur ein verdammter Speicher ist da, ein Dachboden voller Staub, Spinnweben, zurückgelassenem Müll und ausrangierter Möbelstücke der Vormieter, praktisch direkt über meiner Zimmerdecke.
Die Wohnung ist neu. Teil eines neuen Lebens. Hoffe ich jedenfalls. Noch bin ich dabei, mich einzurichten. An diesem Schreibtisch hier sitze ich drei Stockwerke hoch über dem Straßenlärm. Über mir und diesem Speicher haust ein Schlag Tauben, dann kommt nur noch der Himmel.
Direkt unterhalb meines Fensters schwankt eine Laterne an einem dicken Draht über der Straße im Wind. Ihr gelber Schein tastet den Asphalt ab, während sich in den Fensterscheiben gegenüber die Lichterfront eines Kinos spiegelt. Tagsüber brüten hinter diesen Scheiben BWL-Studenten. Wenn sie wollten, könnten sie zu mir reinschauen, wie ich am Schreibtisch sitze. Aber ich sitze selten tagsüber hier.
Wenn ich die drei Stockwerke runter gehe und aus der Haustür trete, tagsüber, dann stellt sich mir eine Traube aus Fahrgästen der städtischen Verkehrsbetriebe entgegen, aus Einkäufern und Rumtreibern, aus überforderten Jungmüttern mit Kinderwagen und lebenssicheren BWL-Studentinnen mit Aktenordern. Aber ich gehe selten tagsüber runter.
Ein Kollege hat mir mal gesagt, wenn man in unserem Job anfängt, Tagebuch zu schreiben, dann ist das der Anfang vom Ausstieg. Ich habe erst kürzlich mit dem Schreiben angefangen. Nicht jede Nacht. Aber fast jede. Ich schreibe ein Heft voll, schmeiße es weg, fange ein neues an. Ich habe einen ganzen Stapel davon im Regal neben dem Schreibtisch. Ein Sonderangebot aus dem Kaufhaus.
Langes Wochenende. Mit dem Tag der Arbeit am Montag als Draufgabe. Kampftag der Arbeiterbewegung – und alle haben frei. Die Stammkunden sind ganz versessen darauf, dass ihnen die Vorräte nicht ausgehen. Erst in letzter Minute entscheiden sie sich, was zu kaufen, aber dann brauchen sie es sofort. Mein Handy gibt kaum Ruhe.
Es ist neun Uhr am Abend, als ich aus dem Haus trete. Die Fahrgäste der städtischen Verkehrsbetriebe, die Einkäufer und Rumtreiber, die überforderten Jungmütter mit ihren Kinderwagen und die lebenssicheren BWL-Studentinnen mit ihren Aktenordern haben sich alle verzogen. Der Wind treibt alte Zeitungen und Werbeprospekte durch die Straße. Vor dem Kino steht mein BMW. Die schwarze Lackierung des 3erCoupés glänzt in der Lichterfront, die einen Film namens Safe Haven ankündigt. Die Xenon-Scheinwerfer blitzen auf, als ich die Türverriegelung aufschnappen lasse, das Chrom der Sternspeichen glänzt kurz im Licht.
Autorenfoto: Carina Faust
weiterlesen
weniger
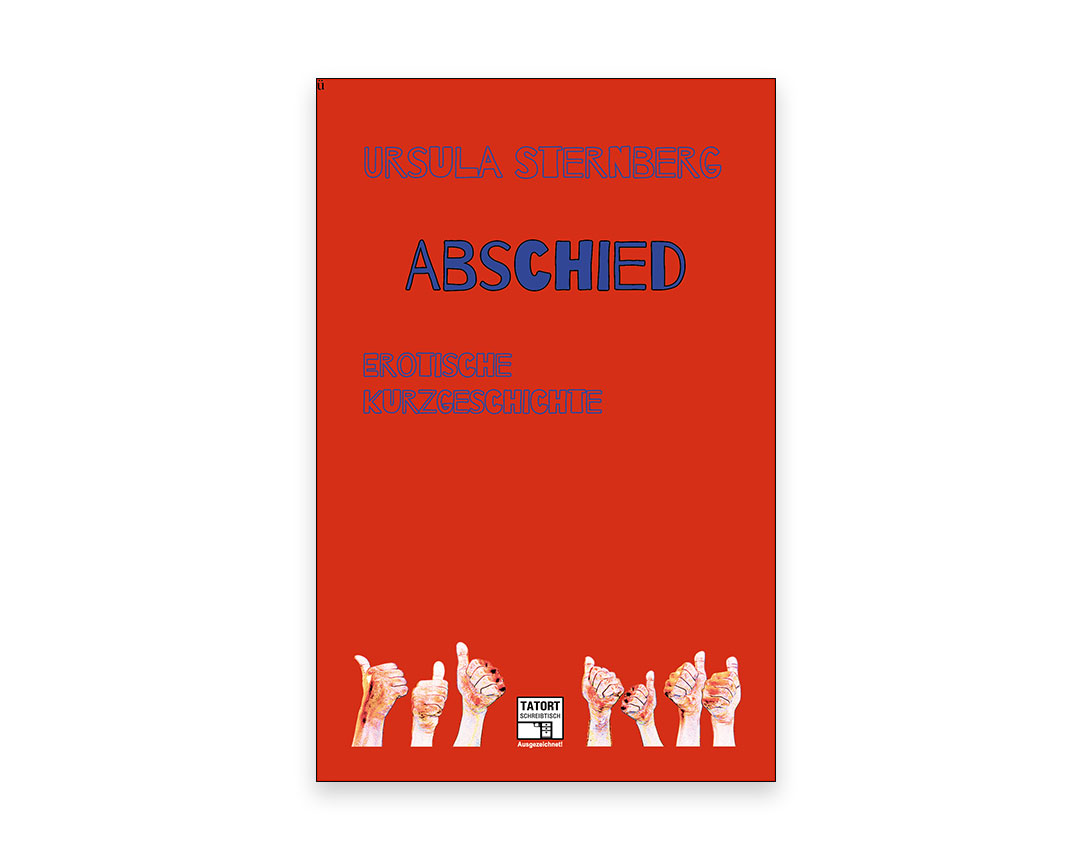
Tatort Schreibtisch: Ausgezeichnet!
Nein. Vielmehr ein Versprechen. Eine poetische Verneigung vor der schönsten Nebensächlichkeit der Welt...
Eine sprachgewaltige poetische Hymne an die Liebe
Die erotische Kurzgeschichte „Abschied“ stand 2012 in der Long-List für den Menantes-Preis für erotische Dichtung und war Teil der Best-of-Anthologie.
ISBN 9783946312390
E-Book zum Download: 1,99 €
E-Book ohne Anmeldung kaufen

Ursula Sternberg, geboren 1958, wuchs in Frankfurt auf, studierte Lehramt für Kunst und Geschichte und schulte anschließend in die IT-Branche um, wo sie seitdem als Anwendungsentwicklerin und Systemanalytikerin arbeitet. Seitdem lebt sie wieder im Ruhrgebiet, davon über 30 Jahre in Essen, und ist mit der Region tief verwurzelt. Ihre Liebe zur Sprache und damit auch zum Schreiben entdeckte sie schon früh, und bevor ihre ersten beiden Krimis erschienen sind, hat sie eine ganze Reihe von Kurzgeschichten geschrieben, die weitestgehend unveröffentlicht sind. „Abschied“ ist eine dieser Kurzgeschichten.
LESEPROBE
Nur wollt ich lieber Deine Hure sein als Mutter Deiner Kinder. Nicht käuflich, nein, nur einfach die Gespielin unser beider Lust. Schon immer wollt ich das. Ich wusste nur nicht, wie es auszuleben.
Das heißt, gewusst hab ich es schon. Doch hab ich meine Zeit bei Dir verbracht mit Warten. Mit Warten auf den Sturm, den Drang, der doch nur selten kam. Mit Sucht nach Nähe, kaum mir je genug, und Hoffen, dass beim nächsten Mal der wilde Funke uns entzündet, den ich suche.
Du hast Dich nie an mir besoffen, den Tanz nicht ausgelebt. Kein Vorwurf, nein. Ich hab Dir diesen Tanz auch kaum eröffnet, erstickte ihn in ungelenker Sprache. Und was heraus kam, baute sich als Hürde vor Dir auf, als Zwangsjacke, die Lust und Geilheit zügelnd.
Auch heute noch bist Du verletzt, selbst wenn ich nun schon lange fort bin. Verraten hab ich Dich und unsere Liebe, geopfert einer schnöden Gier, so siehst Du das. Von mir aus nenn es so, ich kann’s nicht ändern.
Denn es ist wahr! Ich will die Lust. Will geil sein, zwei Mal, drei Mal, und ein weiteres Mal mit meiner eignen Hand mich streicheln, bis ich dann wieder berste, Geschöpf der Sinnlichkeit, zu dem ich werden kann.
So war es nicht bei uns. Doch lernen kann man nur, wenn man es nicht verachtet. Dich hat mein Wunsch nach Öfter, Anders, Mehr, so schien es, eher abgestoßen. Das passte nicht zusammen, nicht in diesem Punkt.
Es gab so viele andre schöne Dinge, höre ich Dich sagen. Stimmt. Und vieles andre passte gut. Doch das hier nicht. Da schienen die Bedürfnisse zu unterschiedlicher Natur. Nur – davon wolltest Du nichts wissen.
Drum nimm’s zur Kenntnis, höre es Dir an, wie ich es will, damit Du endlich richtig Abschied nehmen kannst von mir. Es ist nicht Deins. Nicht besser, aber auch nicht schlechter. Nur nicht Deins.
Ich will bereits am Morgen dieses Prickeln in mir spüren, wohl wissend, dass auch Dir der Kamm schon in der Hose schwillt vor Freude, weil am Abend wir uns wieder sehen werden.
Ich will an Küssen mich ergötzen, nass und glitschig, bis mir der ganze Mund vor Wollust schwillt und das Begehren wuchtig in den Unterleib gefahren ist.
Will einfach nur Dir meinen Duft darbieten, auf dass Du Dich daran besaufen kannst. Dein Stöhnen will ich hören, wenn Du Dein Gesicht in meine Nässe gräbst, und wenn ich langsam dann den Linien Deines Körpers folge, will ich ganz prall und hart den Stab und Deine Geilheit fühlen...
Autorenfoto: Sarah Kostka
Ursula Sternberg: Abschied
Eine Frau, ein innerer Monolog und der Hunger nach erotischer Begegnung: Wirklich ein Abschied?Nein. Vielmehr ein Versprechen. Eine poetische Verneigung vor der schönsten Nebensächlichkeit der Welt...
Eine sprachgewaltige poetische Hymne an die Liebe
Die erotische Kurzgeschichte „Abschied“ stand 2012 in der Long-List für den Menantes-Preis für erotische Dichtung und war Teil der Best-of-Anthologie.
ISBN 9783946312390
E-Book zum Download: 1,99 €
E-Book ohne Anmeldung kaufen

Ursula Sternberg, geboren 1958, wuchs in Frankfurt auf, studierte Lehramt für Kunst und Geschichte und schulte anschließend in die IT-Branche um, wo sie seitdem als Anwendungsentwicklerin und Systemanalytikerin arbeitet. Seitdem lebt sie wieder im Ruhrgebiet, davon über 30 Jahre in Essen, und ist mit der Region tief verwurzelt. Ihre Liebe zur Sprache und damit auch zum Schreiben entdeckte sie schon früh, und bevor ihre ersten beiden Krimis erschienen sind, hat sie eine ganze Reihe von Kurzgeschichten geschrieben, die weitestgehend unveröffentlicht sind. „Abschied“ ist eine dieser Kurzgeschichten.
LESEPROBE
Nur wollt ich lieber Deine Hure sein als Mutter Deiner Kinder. Nicht käuflich, nein, nur einfach die Gespielin unser beider Lust. Schon immer wollt ich das. Ich wusste nur nicht, wie es auszuleben.
Das heißt, gewusst hab ich es schon. Doch hab ich meine Zeit bei Dir verbracht mit Warten. Mit Warten auf den Sturm, den Drang, der doch nur selten kam. Mit Sucht nach Nähe, kaum mir je genug, und Hoffen, dass beim nächsten Mal der wilde Funke uns entzündet, den ich suche.
Du hast Dich nie an mir besoffen, den Tanz nicht ausgelebt. Kein Vorwurf, nein. Ich hab Dir diesen Tanz auch kaum eröffnet, erstickte ihn in ungelenker Sprache. Und was heraus kam, baute sich als Hürde vor Dir auf, als Zwangsjacke, die Lust und Geilheit zügelnd.
Auch heute noch bist Du verletzt, selbst wenn ich nun schon lange fort bin. Verraten hab ich Dich und unsere Liebe, geopfert einer schnöden Gier, so siehst Du das. Von mir aus nenn es so, ich kann’s nicht ändern.
Denn es ist wahr! Ich will die Lust. Will geil sein, zwei Mal, drei Mal, und ein weiteres Mal mit meiner eignen Hand mich streicheln, bis ich dann wieder berste, Geschöpf der Sinnlichkeit, zu dem ich werden kann.
So war es nicht bei uns. Doch lernen kann man nur, wenn man es nicht verachtet. Dich hat mein Wunsch nach Öfter, Anders, Mehr, so schien es, eher abgestoßen. Das passte nicht zusammen, nicht in diesem Punkt.
Es gab so viele andre schöne Dinge, höre ich Dich sagen. Stimmt. Und vieles andre passte gut. Doch das hier nicht. Da schienen die Bedürfnisse zu unterschiedlicher Natur. Nur – davon wolltest Du nichts wissen.
Drum nimm’s zur Kenntnis, höre es Dir an, wie ich es will, damit Du endlich richtig Abschied nehmen kannst von mir. Es ist nicht Deins. Nicht besser, aber auch nicht schlechter. Nur nicht Deins.
Ich will bereits am Morgen dieses Prickeln in mir spüren, wohl wissend, dass auch Dir der Kamm schon in der Hose schwillt vor Freude, weil am Abend wir uns wieder sehen werden.
Ich will an Küssen mich ergötzen, nass und glitschig, bis mir der ganze Mund vor Wollust schwillt und das Begehren wuchtig in den Unterleib gefahren ist.
Will einfach nur Dir meinen Duft darbieten, auf dass Du Dich daran besaufen kannst. Dein Stöhnen will ich hören, wenn Du Dein Gesicht in meine Nässe gräbst, und wenn ich langsam dann den Linien Deines Körpers folge, will ich ganz prall und hart den Stab und Deine Geilheit fühlen...
Autorenfoto: Sarah Kostka
weiterlesen
weniger

Tatort Schreibtisch: Ausgezeichnet!
Rasant und wortgewandt!
Die Short-Story „Eine Schweizer Gute-Nacht-Geschichte“ wurde im Rahmen der Betzdorfer Krimitage 2011 mit dem Blutigen Messer ausgezeichnet.
ISBN 9783946312468
E-Book zum Download: 1,99 €
E-Book ohne Anmeldung kaufen

Roger M. Fiedler, geobren 1961, veröffentlichte seinen ersten Roman im Alter von 35 Jahren - sein Debüt, der München-Krimi "Sushi, Ski und schwarze Sheriffs", wurde mit dem Deutschen Krimipreis (2. Platz) ausgezeichnet. Fiedlers dritter Roman, "Dreamin’ Elefantz", erhielt den Marlowe der Ulmer Chandler-Gesellschaft. Seinen fünften Roman, "Pilzekrieg", feierte die Presse als den ersten Antiregionalkrimi in deutscher Sprache. Seine erste Kurzgeschichte schrieb Fiedler für Penthouse. Zahlreiche weitere Kurzgeschichten in verschiedenen Anthologien und Zeitschriften kamen seither hinzu. Zuletzt wurde "Killshot-App" für den Glauser (Sparte: Kurzgeschichten) nominiert. Eine Schweizer Gute-Nacht-Geschichte entstand als Hommage an das Hotelpersonal, mit dem man als Autor im Laufe einer Lesereise Freundschaft schließt - oder auch nicht.
Leseprobe
Ich saß damals in einem Hotel in Zug in der Schweiz. Das Hotel hieß Zimmer, was später am Abend noch ein großes Thema werden sollte.
Es war nichts los in diesem Hotel, weder im rustikalen „Kaminsims“, dem angegliederten Bistro-Restaurant, noch beim Frisör in der Halle, noch in den knautschigen Ledersesseln im Entrée herrschte Betrieb. Mehr als ein hinter den monumentalen Glasscheiben draußen in der Ferne im Städtchen bellender Hund war nicht zu hören, und zu sehen gar nichts als ruhende Berge. Ich las eine im Foyer liegende Zeitung und trank erst Kaffee, dann, als ich wusste, von welcher Qualität er war, stieg ich auf ein Lammsbräu Weizenbier um und versuchte, aus Langeweile, das Synonymenrätsel der Zeitung zu lösen, als sich jemand von hinten an mich schlich.
Sischt ki guati Ziet – oder so ähnlich hörte ich ihn sagen.
Das Schweizer Idiom findet keinen rechten Eingang in mein Ohr, und wenn es einen fände, entzöge es sich dahinter der Aufnahme durch einen bockenden Gehirnlappen, und würde dieser es akzeptieren, nähme der ausgelöste Gedanke wahrscheinlich die Gestalt eines Urschlammwesens an, einer Verbalamöbe.
Ich antwortete in dem mir eigenen Urschlammidiom, dem Rheinischen Akzent, den ich in seltenen Momenten reaktivieren kann, um Waffengleichheit herzustellen: Bisse mit mich dran, Jung? (Sprichst du mit mir, Bursche?)
Es war der Portier. Er hatte gerade die Spätabendsoap des Schweizer Fernsehens hinter sich gebracht, und nun war ihm nach Trost zu Mute, wie es schien. Der Portier blickte mich streng an, so als wollte er mir verbieten, mit dem Kugelschreiber in seinem Zeitungsrätsel zu krakeln. Seine Zeitung, sein Rätsel, dachte ich. Wahrscheinlich hatte ich ihm eines aufgesparten Vergnügens für die langen Nachtstunden beraubt, der Lösung dieses Rätsels, wahrscheinlich seine beliebteste Nachtbeschäftigung, die Beschäftigung eines Nachtportiers. Ich legte das Rätsel zur Seite.
Den Portier mochte ich auf Anhieb. Ein längliches Gesicht mit einem offenstehenden Pferdegebiß, der Typ Fernandel in Pagenkleidung. Etwas Faustisches ging von ihm aus. Er wirkte ein bisschen wie ein verkleidetes Genie, ungarischer Universitätsprofessor im Nebenerwerb, hätte ich getippt, wäre da nicht diese Sprache gewesen. Diesen Dialekt kann man nicht imitieren. Der wird einem in die Wiege gelegt. Dieser Mann hier war Schweizer Urgestein.
Samstag Abend, nichts zu tun, kaum Gäste da und nur mäßig gute Laune. Er war gekommen, um mich in die Pfanne zu hauen, das spürte ich instinktiv. Ich war mir sicher, es lag an dem Rätsel, das ich ihm weggenommen hatte. Es schwang in seiner Stimme, es glänzte in seinen Augen, es bog seine Mundwinkel zur schelmischen Grimasse. Es legte seine Zähne frei. Der Beisstrieb.
Gut, dachte ich, warum nicht? Und nahm noch einen Schluck Bier ...
Roger M. Fiedler: Eine Schweitzer Gute-Nacht-Geschichte
Ein abgelegenes Hotel in der Schweiz. Ein gelangweilter Portier. Ein Gast. Ein geschasster Detektiv. Die Dinge nehmen ihren Lauf, als der Falsche zur Zeitung greift und das Rätsel lösen will...Rasant und wortgewandt!
Die Short-Story „Eine Schweizer Gute-Nacht-Geschichte“ wurde im Rahmen der Betzdorfer Krimitage 2011 mit dem Blutigen Messer ausgezeichnet.
ISBN 9783946312468
E-Book zum Download: 1,99 €
E-Book ohne Anmeldung kaufen

Roger M. Fiedler, geobren 1961, veröffentlichte seinen ersten Roman im Alter von 35 Jahren - sein Debüt, der München-Krimi "Sushi, Ski und schwarze Sheriffs", wurde mit dem Deutschen Krimipreis (2. Platz) ausgezeichnet. Fiedlers dritter Roman, "Dreamin’ Elefantz", erhielt den Marlowe der Ulmer Chandler-Gesellschaft. Seinen fünften Roman, "Pilzekrieg", feierte die Presse als den ersten Antiregionalkrimi in deutscher Sprache. Seine erste Kurzgeschichte schrieb Fiedler für Penthouse. Zahlreiche weitere Kurzgeschichten in verschiedenen Anthologien und Zeitschriften kamen seither hinzu. Zuletzt wurde "Killshot-App" für den Glauser (Sparte: Kurzgeschichten) nominiert. Eine Schweizer Gute-Nacht-Geschichte entstand als Hommage an das Hotelpersonal, mit dem man als Autor im Laufe einer Lesereise Freundschaft schließt - oder auch nicht.
Leseprobe
Ich saß damals in einem Hotel in Zug in der Schweiz. Das Hotel hieß Zimmer, was später am Abend noch ein großes Thema werden sollte.
Es war nichts los in diesem Hotel, weder im rustikalen „Kaminsims“, dem angegliederten Bistro-Restaurant, noch beim Frisör in der Halle, noch in den knautschigen Ledersesseln im Entrée herrschte Betrieb. Mehr als ein hinter den monumentalen Glasscheiben draußen in der Ferne im Städtchen bellender Hund war nicht zu hören, und zu sehen gar nichts als ruhende Berge. Ich las eine im Foyer liegende Zeitung und trank erst Kaffee, dann, als ich wusste, von welcher Qualität er war, stieg ich auf ein Lammsbräu Weizenbier um und versuchte, aus Langeweile, das Synonymenrätsel der Zeitung zu lösen, als sich jemand von hinten an mich schlich.
Sischt ki guati Ziet – oder so ähnlich hörte ich ihn sagen.
Das Schweizer Idiom findet keinen rechten Eingang in mein Ohr, und wenn es einen fände, entzöge es sich dahinter der Aufnahme durch einen bockenden Gehirnlappen, und würde dieser es akzeptieren, nähme der ausgelöste Gedanke wahrscheinlich die Gestalt eines Urschlammwesens an, einer Verbalamöbe.
Ich antwortete in dem mir eigenen Urschlammidiom, dem Rheinischen Akzent, den ich in seltenen Momenten reaktivieren kann, um Waffengleichheit herzustellen: Bisse mit mich dran, Jung? (Sprichst du mit mir, Bursche?)
Es war der Portier. Er hatte gerade die Spätabendsoap des Schweizer Fernsehens hinter sich gebracht, und nun war ihm nach Trost zu Mute, wie es schien. Der Portier blickte mich streng an, so als wollte er mir verbieten, mit dem Kugelschreiber in seinem Zeitungsrätsel zu krakeln. Seine Zeitung, sein Rätsel, dachte ich. Wahrscheinlich hatte ich ihm eines aufgesparten Vergnügens für die langen Nachtstunden beraubt, der Lösung dieses Rätsels, wahrscheinlich seine beliebteste Nachtbeschäftigung, die Beschäftigung eines Nachtportiers. Ich legte das Rätsel zur Seite.
Den Portier mochte ich auf Anhieb. Ein längliches Gesicht mit einem offenstehenden Pferdegebiß, der Typ Fernandel in Pagenkleidung. Etwas Faustisches ging von ihm aus. Er wirkte ein bisschen wie ein verkleidetes Genie, ungarischer Universitätsprofessor im Nebenerwerb, hätte ich getippt, wäre da nicht diese Sprache gewesen. Diesen Dialekt kann man nicht imitieren. Der wird einem in die Wiege gelegt. Dieser Mann hier war Schweizer Urgestein.
Samstag Abend, nichts zu tun, kaum Gäste da und nur mäßig gute Laune. Er war gekommen, um mich in die Pfanne zu hauen, das spürte ich instinktiv. Ich war mir sicher, es lag an dem Rätsel, das ich ihm weggenommen hatte. Es schwang in seiner Stimme, es glänzte in seinen Augen, es bog seine Mundwinkel zur schelmischen Grimasse. Es legte seine Zähne frei. Der Beisstrieb.
Gut, dachte ich, warum nicht? Und nahm noch einen Schluck Bier ...
weiterlesen
weniger
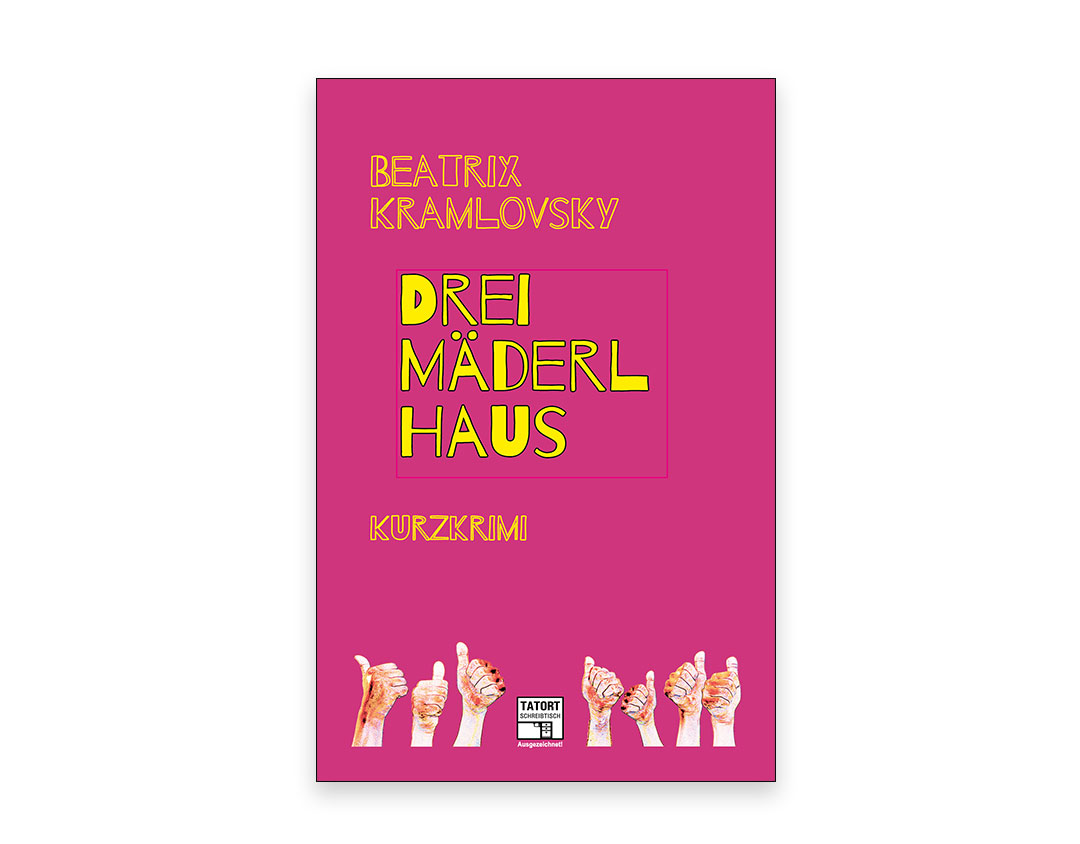
Tatort Schreibtisch: Ausgezeichnet!
Beatrix Kramlovsky: Dreimäderlhaus
Eine Wahrheit zuviel kann wie Gift wirken. Die Frage ist bloß: lebt es sich mit einer Tragödie besser?Berta erledigt für sich und ihre Zwillingsschwestern Haushalt, Garten,
Küche und nebenher genießt sie versteckte Freuden mit Handwerkern oder
Tankwagenfahrern. Eine genügsame Frau, die das Leben als vielstimmiges
Konzert erlebt. Doch ein Mißton schleicht sich ein und Harmonie braucht
manchmal mehr als etwas Bemühen...
Ein giftig-böses Altschwesternidyll!
Die Kurzgeschichte „Dreimäderlhaus“ wurde im Jahr 2014 für den Friedrich-Glauser-Preis in der Sparte Kurzkrimi nominiert.
ISBN 9783946312413
E-Book zum Download: 2,99 €
E-Book ohne Anmeldung kaufen

Beatrix Kramlovsky, 1954 in Österreich geboren, ist vehemente Europäerin im Weinviertel, Schriftstellerin sowie bildende Künstlerin mit den Lebensthemen Aus- und Abgrenzungen und gewaltsamer Tod. Als Literaturvermittlerin ist sie an Universitäten in vielen Ländern und Kulturen tätig. Sie gewann mehrere Literaturpreise und Kunststipendien und wurde 2004, 2005 und 2014 für den Friedrich Glauser-Preis für die beste Krimikurzgeschichte im Deutschen Sprachraum nominiert. Zuletzt erschienen die Romane »Invasion der Wünsche« und »Der vergessene Name. Eine verspätete Liebesgeschichte« (beide im Kitab Verlag) Die Krimigeschichte „Die Fratze“ erschien im Februar 2017 als „Portrait of a Lady“ im renommierten EQMM in New York (Übersetzung von Mary Tannert).
Leseprobe
Berta sah zu, wie der junge Mann den Stutzen durch das schmale Fenster schob. Genaugenommen sah sie von ihm nur kurz grobe Arbeitshandschuhe, die den dicken Schlauch umfassten, die stählerne Manschette mit dem Kettchen daran, das silbern leuchtende Ausgussrohr, eine riesige Tülle, die sich langsam senkte wie der Kopf einer müden Schlange.
Schön, dachte Berta, und dass der junge Mann sehr vorsichtig den Schlauch abgewickelt und durch den Vorgarten gelegt hatte. Eine Zeitlang passierte gar nichts, dann hörte sie ihn die Kellerstiege herunter hüpfen.
Dynamisch und gut aufgelegt, dachte Berta weiter, und dass ihr solche Männer immer gefallen hatten. Der Mann drückte sich mit einer Entschuldigung an ihr vorbei, stieg über die hohe Sicherheitsschwelle des Heizungsraumes, ging zur Fensterwand, packte den Stutzen und zog ihn hinüber zum Tank. Mit welcher Leichtigkeit er den Deckel abschraubte, die Verbindung zum Wagen draußen herstellte. Trotz der Vliesjacke bildete sich Berta ein, das Muskelspiel im Oberarm und auf dem Schulterblatt erahnen zu können.
„Dos hamma glei“, sagte der Mann und lief wieder hinauf, um den Hahn am Tankwagen zu öffnen. Ein leichter Akzent, fand Berta, melodiös, als spielte eine Bassflöte den Satz vor. Dos-ham maglei. Schalmeienmusik. Schubert hätte daraus das Leitmotiv für eines seiner Kunstlieder geformt, da war sie sicher.
„Bertaaa!“ schrie oben mit zittrigem Diskant die jüngste Schwester. „Die Haustür ist offen, es zieht!“
Es zieht, es zieht, dachte Berta und wie fein es wäre, wenn Helgas lächerliche Zipperleins sich endlich in einer gestandenen Lungenentzündung auflösten. Schmerzende Bronchien, Stechen bei jedem Atemzug, vor allem aber keine Stimme, ein nutzloser Kehlkopf, Stille, Stille allüberall.
„Bertaaa!“
Gott war nicht auf ihrer Seite. Berta drehte sich von der Sicherheitstür zum Tankraum weg, die Gewichte brachten die Angeln zum Quietschen. A Dur. Ein hübscher Ton für ein dunkles Kellereck. Sanft fiel die Metalltür ins Schloss. Berta keuchte die Stufen hoch. Vermutlich saßen die Zwillinge wie hingemalt im Wohnzimmer.
Berta schaut beim offenen Eingang hinaus. Der junge Mann hatte sich gerade zum Führerhaus hoch geschwungen, ein handlicher Popo in engen Jeans, Stiefel mit schief getretenen Absätzen. Was für ein belebender Anblick, dachte Berta, und dass der Alltag unerwartete Freuden bereithielt.
Noch bevor sie etwas sagen musste, und wie immer wäre ihr wohl nichts Gescheites eingefallen oder sie hätte zu stottern begonnen, drehte sich der Mann um, die Auftragszettel in der Hand, winkte damit und rief: „Kommaglei!“ Slowene aus dem Steirischen? Kroate aus dem Burgenland? Egal, sein Mund war voll Musik. Sie würde ihm ein ordentliches Trinkgeld geben.
Berta schaute kurz ins Wohnzimmer. „Das Öl“, erklärte sie knapp. Herta und Helga sahen nicht einmal von ihren Büchern auf. Berta schloss sanft die Tür und wandte sich dem jungen Mann zu.
„Mussa Schlauch kappn.“
Berta nickte selig, ging ihm nach, sah zu, wie er den Hahn draußen schloss, dann die zwei Stufen zum Eingang herauf sprang, an ihr vorbei die Stiege hinunter in den Keller lief. Sie würde ihm nicht folgen können. Nicht so schnell.
Die Jahre waren vorbei, wo sie einen hübschen Lieferanten erfolgreich in ein Eck gedrückt oder aufs Bett gedrängt hatte. Keinen hatte ihr Stottern gestört. Aber seitdem die Zwillinge in Pension waren und daheim residierten, waren die elysischen Bocksprünge Vergangenheit.
Eigentlich waren sie schon viel länger passé, dachte Berta, das letzte Mal war vor sieben Jahren passiert, an einem Mittwoch, bildete sie sich ein, mit einem Paketzusteller. Seitdem führte sie das leidenschaftslose Leben einer Haushälterin, der das Monatsgeld von den Schwestern peinlich genau vorgezählt wurde.
So war das, wenn man nichts Gescheites gelernt und als junge Witwe in Notlage erleichtert die Pflege des schwesterlichen Besitzes übernommen hatte.
„Das ist für Sie“, Berta bezahlte und legte 30 Euro extra in die schwielige Hand. Er hielt Nägel und Haut sauber, ach wäre sie doch jünger, welches Vergnügen hätten sie einander bereiten können!
„Dosgeta nit, dosis zuvil“.
„Das ist nicht zu viel“, bestand Berta und ließ ihre Finger auf den seinen ruhen. Er lächelte sie offen an.
„Gutafrau!“ Ein Haydn-Horn im Schubertlied.
„Und Sie sind ein guter Mann!“
„Hör auf zu sülzen.“ Herta stand hinter ihr, der Mann trat zurück, die Finger glitten voneinander. Berta begleitete ihn stumm zur Tür, sah noch, wie er sorgsam hinter sich das Gartengatter zudrückte, er lächelte und winkte.
Ein giftig-böses Altschwesternidyll!
Die Kurzgeschichte „Dreimäderlhaus“ wurde im Jahr 2014 für den Friedrich-Glauser-Preis in der Sparte Kurzkrimi nominiert.
ISBN 9783946312413
E-Book zum Download: 2,99 €
E-Book ohne Anmeldung kaufen

Beatrix Kramlovsky, 1954 in Österreich geboren, ist vehemente Europäerin im Weinviertel, Schriftstellerin sowie bildende Künstlerin mit den Lebensthemen Aus- und Abgrenzungen und gewaltsamer Tod. Als Literaturvermittlerin ist sie an Universitäten in vielen Ländern und Kulturen tätig. Sie gewann mehrere Literaturpreise und Kunststipendien und wurde 2004, 2005 und 2014 für den Friedrich Glauser-Preis für die beste Krimikurzgeschichte im Deutschen Sprachraum nominiert. Zuletzt erschienen die Romane »Invasion der Wünsche« und »Der vergessene Name. Eine verspätete Liebesgeschichte« (beide im Kitab Verlag) Die Krimigeschichte „Die Fratze“ erschien im Februar 2017 als „Portrait of a Lady“ im renommierten EQMM in New York (Übersetzung von Mary Tannert).
Leseprobe
Berta sah zu, wie der junge Mann den Stutzen durch das schmale Fenster schob. Genaugenommen sah sie von ihm nur kurz grobe Arbeitshandschuhe, die den dicken Schlauch umfassten, die stählerne Manschette mit dem Kettchen daran, das silbern leuchtende Ausgussrohr, eine riesige Tülle, die sich langsam senkte wie der Kopf einer müden Schlange.
Schön, dachte Berta, und dass der junge Mann sehr vorsichtig den Schlauch abgewickelt und durch den Vorgarten gelegt hatte. Eine Zeitlang passierte gar nichts, dann hörte sie ihn die Kellerstiege herunter hüpfen.
Dynamisch und gut aufgelegt, dachte Berta weiter, und dass ihr solche Männer immer gefallen hatten. Der Mann drückte sich mit einer Entschuldigung an ihr vorbei, stieg über die hohe Sicherheitsschwelle des Heizungsraumes, ging zur Fensterwand, packte den Stutzen und zog ihn hinüber zum Tank. Mit welcher Leichtigkeit er den Deckel abschraubte, die Verbindung zum Wagen draußen herstellte. Trotz der Vliesjacke bildete sich Berta ein, das Muskelspiel im Oberarm und auf dem Schulterblatt erahnen zu können.
„Dos hamma glei“, sagte der Mann und lief wieder hinauf, um den Hahn am Tankwagen zu öffnen. Ein leichter Akzent, fand Berta, melodiös, als spielte eine Bassflöte den Satz vor. Dos-ham maglei. Schalmeienmusik. Schubert hätte daraus das Leitmotiv für eines seiner Kunstlieder geformt, da war sie sicher.
„Bertaaa!“ schrie oben mit zittrigem Diskant die jüngste Schwester. „Die Haustür ist offen, es zieht!“
Es zieht, es zieht, dachte Berta und wie fein es wäre, wenn Helgas lächerliche Zipperleins sich endlich in einer gestandenen Lungenentzündung auflösten. Schmerzende Bronchien, Stechen bei jedem Atemzug, vor allem aber keine Stimme, ein nutzloser Kehlkopf, Stille, Stille allüberall.
„Bertaaa!“
Gott war nicht auf ihrer Seite. Berta drehte sich von der Sicherheitstür zum Tankraum weg, die Gewichte brachten die Angeln zum Quietschen. A Dur. Ein hübscher Ton für ein dunkles Kellereck. Sanft fiel die Metalltür ins Schloss. Berta keuchte die Stufen hoch. Vermutlich saßen die Zwillinge wie hingemalt im Wohnzimmer.
Berta schaut beim offenen Eingang hinaus. Der junge Mann hatte sich gerade zum Führerhaus hoch geschwungen, ein handlicher Popo in engen Jeans, Stiefel mit schief getretenen Absätzen. Was für ein belebender Anblick, dachte Berta, und dass der Alltag unerwartete Freuden bereithielt.
Noch bevor sie etwas sagen musste, und wie immer wäre ihr wohl nichts Gescheites eingefallen oder sie hätte zu stottern begonnen, drehte sich der Mann um, die Auftragszettel in der Hand, winkte damit und rief: „Kommaglei!“ Slowene aus dem Steirischen? Kroate aus dem Burgenland? Egal, sein Mund war voll Musik. Sie würde ihm ein ordentliches Trinkgeld geben.
Berta schaute kurz ins Wohnzimmer. „Das Öl“, erklärte sie knapp. Herta und Helga sahen nicht einmal von ihren Büchern auf. Berta schloss sanft die Tür und wandte sich dem jungen Mann zu.
„Mussa Schlauch kappn.“
Berta nickte selig, ging ihm nach, sah zu, wie er den Hahn draußen schloss, dann die zwei Stufen zum Eingang herauf sprang, an ihr vorbei die Stiege hinunter in den Keller lief. Sie würde ihm nicht folgen können. Nicht so schnell.
Die Jahre waren vorbei, wo sie einen hübschen Lieferanten erfolgreich in ein Eck gedrückt oder aufs Bett gedrängt hatte. Keinen hatte ihr Stottern gestört. Aber seitdem die Zwillinge in Pension waren und daheim residierten, waren die elysischen Bocksprünge Vergangenheit.
Eigentlich waren sie schon viel länger passé, dachte Berta, das letzte Mal war vor sieben Jahren passiert, an einem Mittwoch, bildete sie sich ein, mit einem Paketzusteller. Seitdem führte sie das leidenschaftslose Leben einer Haushälterin, der das Monatsgeld von den Schwestern peinlich genau vorgezählt wurde.
So war das, wenn man nichts Gescheites gelernt und als junge Witwe in Notlage erleichtert die Pflege des schwesterlichen Besitzes übernommen hatte.
„Das ist für Sie“, Berta bezahlte und legte 30 Euro extra in die schwielige Hand. Er hielt Nägel und Haut sauber, ach wäre sie doch jünger, welches Vergnügen hätten sie einander bereiten können!
„Dosgeta nit, dosis zuvil“.
„Das ist nicht zu viel“, bestand Berta und ließ ihre Finger auf den seinen ruhen. Er lächelte sie offen an.
„Gutafrau!“ Ein Haydn-Horn im Schubertlied.
„Und Sie sind ein guter Mann!“
„Hör auf zu sülzen.“ Herta stand hinter ihr, der Mann trat zurück, die Finger glitten voneinander. Berta begleitete ihn stumm zur Tür, sah noch, wie er sorgsam hinter sich das Gartengatter zudrückte, er lächelte und winkte.
weiterlesen
weniger

Tatort Schreibtisch: Ausgezeichnet!
Christiane Schwarze: Tonerde
Edda befreite sich mithilfe eines großen Steines von der jahrelangen Gewalt ihres Bruders. Nicht er wurde für seine grausamen Taten bestraft, sondern sie kam in eine psychiatrische Anstalt. Dort entdeckte man ihr künstlerisches Talent, Skulpturen aus Tonerde zu formen...Doch eines Tages geriet ihre ehemalige Lieblingslehrerin in Gefahr. Wie könnte Edda sie retten?
Der Krimi „Tonerde“ erzählt von einer Heldin, die nach gängiger Vorstellung gar keine sein dürfte. Die Spannung speist sich nicht aus blutrünstigen Schilderungen, sondern aus unvorhersehbaren Wendungen und dem leisen Humor zwischen den Zeilen. – Hier besiegen die scheinbar Ohnmächtigen das Böse!
"Tonerde" wurde für den Friedrich-Glauser-Preis 2003 in der Katagorie "Kurzkrimi" nominiert.
ISBN 9783946312475
E-Book zum Download: 1,99 €
E-Book ohne Anmeldung downloaden
 e
e
Christiane Schwarze, geboren 1960 in Uslar und heute in Homberg an der Ohm zuhause, war früher Logopädin mit eigener Praxis und ist heute freie Schriftstellerin. Sie ist Mitglied im Verband Deutscher Schriftsteller und Schriftstellerinnen (VS) sowie der Literaturgesellschaft Hessen e.V. und dem Verein Schreibwerkstatt Marburg. Von ihren sechs veröffentlichten Büchern wurden vier auch in Braille-Schrift herausgebracht. Christane Schwarze kommt auf 270 Einzelveröffentlichungen, die sie bei Lesungen im gesamten Bundesgebiet vorstellt
Leseprobe:
Natürlich war es strengstens verboten, hier zu sein. Aber wenn es einen Platz gab, den sie liebte, dann diesen. Einerseits lag es an der Stille, niemand schrie, nicht mal Erwin brabbelte unverständliche Wortfetzen. Was diesen Ort aber noch wunderbarer machte als die Parkanlage mit dem Entenweiher, war die Tonerde. Den Weg zu der Stelle verriet Edda niemandem, so konnte sie sich einbilden, den Schatz alleine zu besitzen.
Ihre besondere Fähigkeit, Figuren zu formen, mochte sogar den letzten Ausschlag gegeben haben, als der Arzt ihr schließlich eingeschränkten Ausgang erlaubte. Er deutete das Töpfern als Hinweis auf therapeutische Fortschritte.
Vor zwei Jahren gab es dann allerdings folgenreichen Streit deswegen. Ein Professor, der die Einrichtung inspizierte, behauptete, niemals könne eine geistig Behinderte Kunstwerke von solcher Schönheit erschaffen. Er bezichtigte den Leiter, Herrn Roth, auf unlautere Weise Fördermittel erschleichen zu wollen.
Als daraufhin die Heiminsassin vor einem neunköpfigen Expertengremium den Beweis antreten sollte, entstand unter ihren zitternden Händen weder eine Frauenskulptur noch ein tönerner Torso. Nicht einmal eine schlichte Tierfigur konnte als Ergebnis vorgewiesen werden. Die Fachleute verließen kopfschüttelnd den Raum. Nach dieser Blamage würdigte Herr Roth Edda keines Wortes mehr.
Allein blieb sie am Tisch zurück und weinte, bis alles vor ihren Augen verschwamm. Die lehmig-verschmierten Hände fanden wie von alleine die richtigen Bewegungen. Ohne hinzusehen entstand eine kunstvollere Plastik als jemals zuvor.
Damit er ihr nicht mehr böse wäre, bot sie dem Leiter am Abend das Objekt als Geschenk dar. Doch statt sich versöhnt zu zeigen, schlug er mit der Faust so fest gegen ihre Hand, dass die Gabe zu Boden fiel. Seitdem durfte sie nicht mehr an der wöchentlichen Kunsttherapiesitzung teilnehmen, und das bedeutete, kein Material zum Töpfern zu erhalten.
Hätte er zur Strafe wieder geschlossene Unterbringung angeordnet oder sie verprügelt, wäre der Schmerz unbedeutend gewesen, verglichen mit diesem.
Weinte sie anfänglich noch oft und hoffte, die Anordnung werde zurückgenommen, wurden die Tränen mit jedem verstrichenen Tag spärlicher und mit ihnen die Worte.
Das Wunder geschah, nachdem die Putzfrau an einem Dienstag schlechte Laune mitgebracht hatte ...
Der Krimi „Tonerde“ erzählt von einer Heldin, die nach gängiger Vorstellung gar keine sein dürfte. Die Spannung speist sich nicht aus blutrünstigen Schilderungen, sondern aus unvorhersehbaren Wendungen und dem leisen Humor zwischen den Zeilen. – Hier besiegen die scheinbar Ohnmächtigen das Böse!
"Tonerde" wurde für den Friedrich-Glauser-Preis 2003 in der Katagorie "Kurzkrimi" nominiert.
ISBN 9783946312475
E-Book zum Download: 1,99 €
E-Book ohne Anmeldung downloaden
 e
e
Christiane Schwarze, geboren 1960 in Uslar und heute in Homberg an der Ohm zuhause, war früher Logopädin mit eigener Praxis und ist heute freie Schriftstellerin. Sie ist Mitglied im Verband Deutscher Schriftsteller und Schriftstellerinnen (VS) sowie der Literaturgesellschaft Hessen e.V. und dem Verein Schreibwerkstatt Marburg. Von ihren sechs veröffentlichten Büchern wurden vier auch in Braille-Schrift herausgebracht. Christane Schwarze kommt auf 270 Einzelveröffentlichungen, die sie bei Lesungen im gesamten Bundesgebiet vorstellt
Leseprobe:
Natürlich war es strengstens verboten, hier zu sein. Aber wenn es einen Platz gab, den sie liebte, dann diesen. Einerseits lag es an der Stille, niemand schrie, nicht mal Erwin brabbelte unverständliche Wortfetzen. Was diesen Ort aber noch wunderbarer machte als die Parkanlage mit dem Entenweiher, war die Tonerde. Den Weg zu der Stelle verriet Edda niemandem, so konnte sie sich einbilden, den Schatz alleine zu besitzen.
Ihre besondere Fähigkeit, Figuren zu formen, mochte sogar den letzten Ausschlag gegeben haben, als der Arzt ihr schließlich eingeschränkten Ausgang erlaubte. Er deutete das Töpfern als Hinweis auf therapeutische Fortschritte.
Vor zwei Jahren gab es dann allerdings folgenreichen Streit deswegen. Ein Professor, der die Einrichtung inspizierte, behauptete, niemals könne eine geistig Behinderte Kunstwerke von solcher Schönheit erschaffen. Er bezichtigte den Leiter, Herrn Roth, auf unlautere Weise Fördermittel erschleichen zu wollen.
Als daraufhin die Heiminsassin vor einem neunköpfigen Expertengremium den Beweis antreten sollte, entstand unter ihren zitternden Händen weder eine Frauenskulptur noch ein tönerner Torso. Nicht einmal eine schlichte Tierfigur konnte als Ergebnis vorgewiesen werden. Die Fachleute verließen kopfschüttelnd den Raum. Nach dieser Blamage würdigte Herr Roth Edda keines Wortes mehr.
Allein blieb sie am Tisch zurück und weinte, bis alles vor ihren Augen verschwamm. Die lehmig-verschmierten Hände fanden wie von alleine die richtigen Bewegungen. Ohne hinzusehen entstand eine kunstvollere Plastik als jemals zuvor.
Damit er ihr nicht mehr böse wäre, bot sie dem Leiter am Abend das Objekt als Geschenk dar. Doch statt sich versöhnt zu zeigen, schlug er mit der Faust so fest gegen ihre Hand, dass die Gabe zu Boden fiel. Seitdem durfte sie nicht mehr an der wöchentlichen Kunsttherapiesitzung teilnehmen, und das bedeutete, kein Material zum Töpfern zu erhalten.
Hätte er zur Strafe wieder geschlossene Unterbringung angeordnet oder sie verprügelt, wäre der Schmerz unbedeutend gewesen, verglichen mit diesem.
Weinte sie anfänglich noch oft und hoffte, die Anordnung werde zurückgenommen, wurden die Tränen mit jedem verstrichenen Tag spärlicher und mit ihnen die Worte.
Das Wunder geschah, nachdem die Putzfrau an einem Dienstag schlechte Laune mitgebracht hatte ...
weiterlesen
weniger

Tatort Schreibtisch: Ausgezeichnet!
Diana Feuerbach: Turteltauben am Beckenrand
In dieser Geschichte wechseln die Jahre, die Liebhaber, die
Wassertemperaturen ...
... und die Pelzmäntel. Schauplatz ist Karlsbad,
der berühmte böhmische Kurort mit seinen heilenden Quellen. Ein junges
Paar will hier Silvester feiern, doch der Countdown auf Mitternacht
mündet in eine Überraschung...

Diana Feuerbachs Romane und Erzählungen spielen fast immer fern von zu Hause. Weltgewandt und sprachbegabt, taucht Diana Feuerbach mit Vorliebe in andere Länder und Kulturen ein. Insgesamt hat sie sieben Jahre im Ausland verbracht, davon fünf in den USA. Die Absolventin des Deutschen Literaturinstituts, mehrfache Stipendiatin der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und Preisträgerin des MDR Literaturwettbewerbs ist in Stollberg/Erzgebirge geboren und in Chemnitz aufgewachsen, damals Karl-Marx-Stadt. Heute lebt sie in Leipzig.
Leseprobe:
Man erzählte sich, an der Kurpromenade sei ein neuer Gast aufgetaucht. Ein Inder mit Pelzmütze. Es ist zwei Tage nach Neujahr. Die Stadt liegt als verschneites Schmuckkästchen im Tal, am Grund atmet der Fluss, und die blau illuminierten Weihnachtsbäume glitzern in der Iris der Betrachter. An einem Kiosk bei den Kolonnaden hat sich der Inder eine Quellwassertasse gekauft. Sie ist weiß, flachbäuchig mit Schnabel und Goldrand und mit einer altmodischen Szenerie bedruckt, in der Damen in langen Kleidern am Arm von zwirbelbärtigen Kavalieren wandeln.
Der Inder ist barfuß. Er trägt eine grau gesprenkelte Fellmütze auf dem Kopf und ein Handtuch um die Hüften. Sonst nichts. Mit seiner Tasse in der Hand geht er von Brunnen zu Brunnen, bückt sich zu den verkrusteten Hähnen, aus denen das Heilwasser dampft, füllt sein Gefäß und trinkt. Um ihn herum flanieren Frauen in Pelzmänteln, die Kapuzen wie gefiederte Kissen über die Köpfe gestülpt, Wangen und Lippen in frostroten Farben geschminkt. Winterfeen könnten sie sein vor dieser Kulisse, die den Inder fast kolonial anmuten muss mit ihren frieslig geschnitzten Pavillions und zierlichen Parkbänken. Feen könnten sie sein ‒ wenn sie nicht ihre Ehemänner und Kinder im Schlepp hätten, und wenn sie in einer anderen Sprache tuscheln würden.
Bis zum Silvesterabend des alten Jahres hat sich der Inder mit keiner Faser seines Gemüts für das Russische interessiert, weshalb es ihn zu keiner nennenswerten Reaktion bewegen konnte. Das mag nun anders sein, denn er hält seine Ohren mit den Klappen der Fellmütze bedeckt. Er bückt sich zu den Brunnen, benetzt sein Gesicht und den nackten Oberkörper mit dem Heilwasser und singt halblaut in einer Sprache, die hier niemand versteht. Er gurgelt sogar, ehe er trinkt. Gurgeln ist so unüblich hier, dass der Mann sämtliche Blicke auf sich zieht, und weil ihm die Fellmütze schief in den Nacken gerutscht ist, wirkt er nun ganz und gar wie ein trauriger Klamauk.
Der Arme, möchte man denken, ganz allein in Karlsbad. Wo ist seine indische Busgruppe? Es gibt keine, so sieht die Sache aus. Der Mann ist allein unterwegs. Obwohl er, wie ich zugeben muss, nicht allein angereist ist. Sein Auto, ein Kleinwagen mit deutschem Kennzeichen, steht auf einem Bezahlparkplatz nicht weit vom Elisabethbad und einem Mietshaus, in dem er ein Apartment gebucht hat für den Wechsel vom alten zum neuen Jahr. Schäbiger Treppenaufgang. Über den Mülltonnen im Foyer hängt ein Spiegel. Dazu der Geruch von vergammelter Milchsuppe. Der Inder ist ein gemächlicher Typ, man bringt ihn nicht so schnell aus der Ruhe. Er ist in Kalkutta geboren und in Ermangelung einer echten Berufung früh zum Softwareingenieur geworden. Seine Kaste hat er mir nie verraten; über so etwas spricht er nicht.
Am Silvesterabend, kurz nach unserer Ankunft in der Ferienwohnung, haben wir uns beide verletzt...
"Turteltauben am Beckenrand" wurde 2010 mit dem Publikumspreis des MDR Literaturpreises ausgezeichnet.
ISBN 9783946312505
E-Book zum Download: 1,99 €
E-Book ohne Anmeldung downloaden

Diana Feuerbachs Romane und Erzählungen spielen fast immer fern von zu Hause. Weltgewandt und sprachbegabt, taucht Diana Feuerbach mit Vorliebe in andere Länder und Kulturen ein. Insgesamt hat sie sieben Jahre im Ausland verbracht, davon fünf in den USA. Die Absolventin des Deutschen Literaturinstituts, mehrfache Stipendiatin der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und Preisträgerin des MDR Literaturwettbewerbs ist in Stollberg/Erzgebirge geboren und in Chemnitz aufgewachsen, damals Karl-Marx-Stadt. Heute lebt sie in Leipzig.
Leseprobe:
Man erzählte sich, an der Kurpromenade sei ein neuer Gast aufgetaucht. Ein Inder mit Pelzmütze. Es ist zwei Tage nach Neujahr. Die Stadt liegt als verschneites Schmuckkästchen im Tal, am Grund atmet der Fluss, und die blau illuminierten Weihnachtsbäume glitzern in der Iris der Betrachter. An einem Kiosk bei den Kolonnaden hat sich der Inder eine Quellwassertasse gekauft. Sie ist weiß, flachbäuchig mit Schnabel und Goldrand und mit einer altmodischen Szenerie bedruckt, in der Damen in langen Kleidern am Arm von zwirbelbärtigen Kavalieren wandeln.
Der Inder ist barfuß. Er trägt eine grau gesprenkelte Fellmütze auf dem Kopf und ein Handtuch um die Hüften. Sonst nichts. Mit seiner Tasse in der Hand geht er von Brunnen zu Brunnen, bückt sich zu den verkrusteten Hähnen, aus denen das Heilwasser dampft, füllt sein Gefäß und trinkt. Um ihn herum flanieren Frauen in Pelzmänteln, die Kapuzen wie gefiederte Kissen über die Köpfe gestülpt, Wangen und Lippen in frostroten Farben geschminkt. Winterfeen könnten sie sein vor dieser Kulisse, die den Inder fast kolonial anmuten muss mit ihren frieslig geschnitzten Pavillions und zierlichen Parkbänken. Feen könnten sie sein ‒ wenn sie nicht ihre Ehemänner und Kinder im Schlepp hätten, und wenn sie in einer anderen Sprache tuscheln würden.
Bis zum Silvesterabend des alten Jahres hat sich der Inder mit keiner Faser seines Gemüts für das Russische interessiert, weshalb es ihn zu keiner nennenswerten Reaktion bewegen konnte. Das mag nun anders sein, denn er hält seine Ohren mit den Klappen der Fellmütze bedeckt. Er bückt sich zu den Brunnen, benetzt sein Gesicht und den nackten Oberkörper mit dem Heilwasser und singt halblaut in einer Sprache, die hier niemand versteht. Er gurgelt sogar, ehe er trinkt. Gurgeln ist so unüblich hier, dass der Mann sämtliche Blicke auf sich zieht, und weil ihm die Fellmütze schief in den Nacken gerutscht ist, wirkt er nun ganz und gar wie ein trauriger Klamauk.
Der Arme, möchte man denken, ganz allein in Karlsbad. Wo ist seine indische Busgruppe? Es gibt keine, so sieht die Sache aus. Der Mann ist allein unterwegs. Obwohl er, wie ich zugeben muss, nicht allein angereist ist. Sein Auto, ein Kleinwagen mit deutschem Kennzeichen, steht auf einem Bezahlparkplatz nicht weit vom Elisabethbad und einem Mietshaus, in dem er ein Apartment gebucht hat für den Wechsel vom alten zum neuen Jahr. Schäbiger Treppenaufgang. Über den Mülltonnen im Foyer hängt ein Spiegel. Dazu der Geruch von vergammelter Milchsuppe. Der Inder ist ein gemächlicher Typ, man bringt ihn nicht so schnell aus der Ruhe. Er ist in Kalkutta geboren und in Ermangelung einer echten Berufung früh zum Softwareingenieur geworden. Seine Kaste hat er mir nie verraten; über so etwas spricht er nicht.
Am Silvesterabend, kurz nach unserer Ankunft in der Ferienwohnung, haben wir uns beide verletzt...
weiterlesen
weniger
